

The Riddle of Possibilities, Self-Creation and Transcendence

|
This essay explores the deepest metaphysical question: Why is there something rather than nothing? It examines two competing explanatory frameworks for the origin of the universe—self-creation through physical laws and emergence from a transcendent source. Central to the investigation is the ontological status of possibility itself, considered not as mere abstraction but as a real dimension of being. The analysis unfolds across multiple levels: quantum fluctuation, cosmological models, the enigma of nothingness, and the evolution of complexity from physics to consciousness. Drawing from both Western metaphysics and Eastern philosophy, the essay develops an “ontology of possibility” that seeks to reconcile scientific, philosophical, and spiritual perspectives. Reality, it argues, may ultimately be rooted not in substance, but in the structured unfolding of what could be.
0. Introduction: Why Is There Something Rather Than Nothing? Prelude: The Origin of the Rules of Nature: Competing Perspectives
I. A Universe from Itself: Self-Creation Without a Creator 1. Quantum Fluctuations as the Origin of a Cosmos 2. The Inflationary Theory and the Multiverse Concept 3. Cyclic Models: Universes Without a Beginning 4. Ockham’s Razor and the Power of Simple Explanations 5. Did Time Have a Beginning? Cosmological Reflections 6. Thermodynamics and the Direction of Time 7. Quantum Gravity: When the Big Bang Is Not a Singularity 8. Philosophical Problems with Infinity and Causal Regress
II. The Universe Through a Transcendent Entity: The Thought of a Creator 1. The Classical Cosmological Argument: First Cause as a Necessary Being 2. Fine-Tuning as a Hint of Intention? 3. Consciousness and Morality as Traces of a Mental Source 4. Science at the Edge of Explanation
III. The Enigma of Nothingness and the Birth of Possibility 1. What Is "Absolute" Nothingness? – Kuhn’s Nine Degrees of Emptiness 2. Ontological Fluctuation: When Nothing Begins to Long for Being 3. Potentiality as a Third Realm Between Nothingness and Being 4. Leibniz Reconsidered: The Necessity of Possibility
IV. Ontology of Possibility – What Could Be and What Becomes 1. Types of Possibility: Logical, Physical, Metaphysical 2. Are Possibilities Real? Thoughts from Lewis, Whitehead, Plantinga 3. How Does a Possibility Become Actual? 4. Physical Traces of the Possible in the Cosmos
V. The Evolution of Being – Stages of Emergence from Possibility 1. Ontological Evolution: From Pure Potential to Something 2. Physical Evolution: Energy, Fields, Space-time, Galaxies 3. Chemical Evolution: Molecules, Compounds, First Complexity 4. Biological Evolution: Life, Cells, Differentiation 5. Psychological Evolution: Consciousness, Language, Culture 6. Technological Evolution: Tools, Computers, AI
VI. Layers of Being – From Matter to Transcendence 1. Physical Reality: Matter, Particles, Quantum Fields 2. Virtual Particles: Fleeting Events in the Quantum Vacuum 3. Quantum Reality: Superposition, Entanglement, Tunneling 4. Laws of Nature: Constant Order and Emergent Regularity 5. Abstract Entities: Mathematics, Logic, Structures 6. Consciousness: First-Person Perspective, Self-Awareness 7. Social Reality: Symbols, Institutions, Cultural Systems 8. Transcendental Reality: The Origin Beyond Space and Time
VII. The Role of Consciousness in the Universe – Observer or Co-Creator? 1. Quantum Mechanics and the Observer Effect 2. Panpsychism: Is Consciousness Fundamental? 3. The Cosmos as a Process of Reflection
VIII. Nothingness and Emptiness in Eastern Thought – Daoist and Buddhist Perspectives 1. Buddhist Emptiness (Śūnyatā) as Dynamic Origin 2. Daoism: Wu and Wu Wei as the Source of All Form 3. Non-Being as the Enabler of All Things 4. Yin and Yang: Interdependence of Being and Non-Being 5. Building Bridges to the West: Emptiness, Physics, and Philosophy
IX. Emerging Theories and Open Horizons – New Pathways Toward Existence 1. The Holographic Principle and the Nature of Reality 2. The Anthropic Principle: Fine-Tuning and the Possibility of Life 3. Digital Physics and the Simulated Reality Hypothesis 4. The Limits of Human Understanding and Future Inquiry 5. Cosmological Natural Selection: A Self-Reproducing Universe? 6. Non-Existence as an Unstable State: Why Something Emerges 7. Quantum Tunneling of a Universe from Nothingness 8. The "No-Boundary" Proposal by Hartle and Hawking 9. The Interplay of Science, Philosophy, and Spirituality 10.The Role of Information Theory in the Study of Existence 11.The Role of Mathematics in Unraveling Reality 12.Causality, Time, and the Arrow of Being 13.The Limits of Language and Conceptual Frameworks 14.Emergence as a Key Concept in the Exploration of Being 15.Symmetry and Symmetry Breaking as Structuring Principles of the World 16.The Role of Human Perception in the Interpretation of Reality 17.The Interconnectedness of All Being: A Holistic Perspective
X. Lived Possibility – Practical Dimensions of Ontological Insight 1. Personal Growth: Seeing Oneself as Part of an Open Reality 2. Decision-Making: Engaging with the Possible, Not Just the Given 3. Creativity: Exploring Untrodden Inner Landscapes 4. Intuition and Inner Wisdom: Trusting the Not-Yet-Grasped 5. Spirituality and Transcendence: Possibility as a Path to Depth
11. Conclusion: Possibility as a primordial ground and bridge between worlds
Review: Between Nothingness and Being
Why Is There Something Rather Than Nothing? (Leibniz)The question of the origin of the universe brings us to the edge of what is thinkable. It touches not only physics and cosmology, but also raises fundamental ontological, metaphysical, and even spiritual questions: Why is there anything at all—and not rather nothing? At the same time, it inevitably leads us into the tension between scientific explanatory models, philosophical assumptions, and existential boundary questions. Two competing positions dominate the debate: (1) the hypothesis of a self-generating universe arising from physical laws, (2) the assumption of a transcendent entity as its cause. Both perspectives raise further key questions—particularly concerning the nature of nothingness and the role of possibility as an independent ontological category: What does it mean for something to be possible? Are possibilities mere mental constructs—or do they possess a kind of reality of their own? And how does a possibility become actual? This essay explores such questions from scientific, philosophical, and spiritual viewpoints. It does not seek to dissolve the tension between opposing explanations like self-creation and creation—but rather to trace them back to a deeper shared foundation: the ontology of possibility—as origin, medium, and horizon of all being. Before we enter the deeper realm of being and becoming, we should pause over a subtler mystery that quietly underpins all others: the order of things. We live in a universe that is not chaotic or anarchic, but remarkably structured—governed by patterns, constants, and principles we call the laws of nature. Some of these laws are specific to particular domains, others appear universal and fundamental. But what is their origin? Why does anything at all obey rules? Before asking why there is something rather than nothing, we might begin with a more immediate riddle: Why is there order rather than disorder? Why does anything that exists conform to lawlike regularities, instead of sheer randomness? This inquiry is more than scientific—it is metaphysical. It invites us to consider whether these laws are discovered or invented, imposed or emergent, eternal or contingent. From scientific naturalism to Platonism, from theistic interpretations to theories of emergence and the multiverse, thinkers have proposed various frameworks to explain this underlying structure. So let us begin our journey into the ultimate “why” of existence by asking: Why are there laws of nature at all?
Prelude: The Origin of the Rules of Nature: Competing Perspectives1 Scientific NaturalismScientific Naturalism holds that the laws of nature are inherent patterns within the physical universe, discoverable through empirical observation. It maintains that all phenomena can be explained by natural causes and without invoking the supernatural. Thinkers such as Willard Van Orman Quine, Paul Kurtz, and Sean Carroll—who promotes "poetic naturalism"—defend this approach. But critics point out that naturalism often presupposes the very laws it seeks to describe. Why these laws, and not others? Why lawfulness at all? Still, scientific naturalism remains the prevailing framework in modern research.→ Laws of Nature in: Stanford Encyclopedia of Philosophy
2 PlatonismPlatonism suggests that the laws of nature are abstract, timeless truths akin to mathematical objects, existing independently of the physical world. Thinkers like Roger Penrose and Max Tegmark claim that reality is, at its core, mathematical. Critics like Lee Smolin, however, warn that Platonism fails to account for temporal change and causal efficacy, raising concerns about the disconnect between abstract form and physical dynamics. Yet its influence in theoretical physics and philosophy of mathematics remains strong. → Platonic Laws of Nature, Canadian Journal of Philosophy
3 Theistic PerspectivesTheistic interpretations propose that the universe’s lawfulness stems from a divine intelligence—a transcendent source of order. Figures like Thomas Aquinas, John Polkinghorne, and Francis Collins attempt to reconcile scientific understanding with theological belief. Their critics challenge the explanatory clarity and empirical relevance of such views. Nevertheless, theological perspectives continue to shape discussions at the intersection of science and metaphysics. → Theism and Laws of Nature, Harvard Theological Review
4 EmergentismEmergentist theories argue that what we call “laws” may arise from the collective behavior of simpler elements. Some patterns cannot be reduced to micro-level descriptions; they are said to “emerge” at higher levels of complexity. Philosophers like C. D. Broad and David Chalmers, as well as physicist Robert Laughlin, explore this framework. Yet critics question whether emergence provides genuine explanatory depth or simply restates observed complexity. Still, emergentism is gaining traction in the sciences of mind, life, and complex systems. → Emergent Properties, Stanford Encyclopedia of Philosophy
5 Multiverse and Anthropic PrinciplesFinally, multiverse theories and the anthropic principle suggest that our universe’s laws are one set among countless others. According to Brandon Carter and Leonard Susskind, we find ourselves in a universe compatible with life simply because we could not observe one that wasn’t. Critics argue this reduces explanation to selection bias, lacking predictive power or testability. Still, such ideas remain prominent in cosmology and theoretical physics. → Anthropic Principle – Wikipedia
I. A Universe from Itself: Self-Creation Without a Creator 1. Quantum Fluctuations as the Origin of a Cosmos The idea that our universe could have emerged from a “nothing” in the physical sense—more precisely, from a quantum vacuum—is among the most fascinating hypotheses of modern cosmology. Such vacuum states are not completely empty but contain a seething field of potential energy, from which—according to the Heisenberg uncertainty principle—particle-antiparticle pairs can spontaneously arise and annihilate again. In some models, such as those of Alexander Vilenkin or Lawrence Krauss, an entire universe can arise from such a ground state through a quantum fluctuation. However, this physical “nothing” is not a metaphysical nothing—it already presupposes spacetime structures or at least physical laws. The idea of a universe that “appears for free” from a zero-energy balance—where the positive energy of matter is canceled by the negative energy of gravity—demands a new kind of thinking: one that understands emergence not as production from substance, but as manifestation from possibility. What arises is the image of a cosmos that is not so much “created” as “happens”—from the depth of quantum potential.
2. Inflationary Theory and the Concept of the Multiverse Inflationary theory was developed to solve certain puzzles in the classical Big Bang model—such as the remarkable homogeneity of the cosmos or its near-perfect flatness. It proposes that the universe underwent a phase of extremely rapid, exponential expansion immediately after the Big Bang. This brief phase, driven by a hypothetical inflaton field—a proposed scalar field regarded as the cause of cosmic inflation—smoothed out spatial curvature and distributed energy almost uniformly. But the theory did not stop there: in many variants, this inflation leads to eternal continuation—a self-replicating process in which new space bubbles constantly arise. Our observable universe would thus be only one of these “bubbles,” embedded in a much larger realm of eternal inflation: a multiverse. This brings forth the idea of a reality that is not reduced to a single, closed universe but consists of an infinite ensemble of different universes—perhaps with entirely different physical laws, dimensions, and constants. The consequence is both thrilling and disquieting: our world would not be necessary, but merely one possibility among countless others. Inflationary theory thus becomes a cosmological portal into a new ontological vastness.
3. Cyclic Models: Universes Without a Beginning Not all cosmological models see the Big Bang as the absolute beginning of space, time, and matter. Already in antiquity, the idea of an eternally pulsating cosmos emerged—for example, in the teachings of the Stoics or in Indian philosophy. In modern physics, such ideas are experiencing a renaissance—such as in the concept of the “ekpyrotic universe,” which arises from the collision of higher-dimensional branes. Loop quantum gravity, too, replaces the Big Bang with a "Big Bounce": a previous universe does not collapse into a singularity but reaches a minimal spacetime state from which it expands again. The cycle of contraction and expansion could continue eternally. Such models not only offer an alternative to the initial singularity but also a new perspective on time: it would not be linearly structured with a point of origin, but circular or oscillatory. The universe would thus not be the result of a one-time act of creation, but the expression of an ancient rhythm—a cosmic breath that flows in and out eternally.
4. Ockham’s Razor and the Power of Simple Explanations Ockham’s Razor—named after the medieval philosopher William of Ockham—is an epistemological principle that states: among multiple theories that explain a phenomenon equally well, the simpler one is to be preferred. Simplicity here does not mean naivety, but economy of thought: as few unproven assumptions as possible, no unnecessary entities, no metaphysical overload. Applied to the origin of the universe, this means: if the universe can be explained—also without an external instance—through physical laws and internal dynamics, then no additional creator instance should be postulated. A theory that works with fewer assumptions and still explains the same phenomena deserves priority. Of course, it remains debated whether simplicity is actually a criterion of truth. But as a heuristic tool, Ockham’s principle has immense value: it urges us not to hastily replace mystery with marvel, but to take the self-sufficiency of the real seriously. In the ontology of possibility, simplicity becomes a benchmark—between metaphysical depth and speculative arbitrariness.
5. Did Time Have a Beginning? Cosmological Reflections The very idea of time having a beginning raises a paradoxical question: Can there be a “before” if time itself begins only with the universe? In classical Big Bang models, the singularity marks the beginning of space and time—a point of infinite density and temperature where our physical theories break down. But newer concepts suggest that the origin of our cosmos does not necessarily coincide with an absolute beginning. Quantum cosmology—such as the Hartle-Hawking “no-boundary” proposal—suggests that spacetime at its origin has no boundary in the usual sense but instead resembles a rounded surface. In such a model, the beginning is not abrupt but smooth—time gradually “emerges” from a quantum structure. Even from a philosophical perspective, the question remains open: Is a beginning of time necessary or only apparent? Is time a fundamental dimension or a derived phenomenon? Can something “begin” without being caused by something else? The ontology of possibility suggests: perhaps the origin of time is not a fixed point, but itself the expression of a process in which possibility unfolds into experience—not with a bang, but with a stillness that gradually becomes pulse and movement.
6. Thermodynamics and the Direction of Time The second law of thermodynamics—known as the law of entropy—states that in a closed system, disorder always increases. This simple principle has far-reaching implications: it gives time a direction. While many physical equations are time-reversible, the world as we experience it is not: ice melts, but melted water does not spontaneously refreeze—at least not without external influence. In cosmology, this raises a provocative question: if the universe had existed eternally without a beginning, shouldn’t it long ago have reached a state of maximum entropy—a “thermal emptiness,” without structure, energy gradients, or life? The fact that our cosmos is still highly structured suggests that it has passed through a state of extremely low entropy—which again points to a beginning. Yet countermodels emerge here as well: in cyclic universes, entropy could be “thinned out” in each cycle or transformed in new ways. Other ideas propose that although the universe as a whole ages entropically, our observable section is simply a local anomaly. Either way, the direction of time is no trivial given—but deeply linked to the state and history of the universe—and thus to the question of whether being is necessary or occurs by chance. Thus, entropy becomes a thermodynamic pointer on the metaphysical clock.
7. Quantum Gravity: When the Big Bang Is Not a Singularity Classical general relativity describes gravity as the curvature of spacetime—but it fails at a crucial point: the singularity of the Big Bang. Where density and temperature become infinite, the equations collapse. To understand this extreme state, we need a theory of quantum gravity—a unification of general relativity and quantum mechanics. Various approaches address the problem in different ways: in loop quantum gravity, spacetime is not conceived as a continuum but as a quantized structure—similar to a network of loops. In this model, the singularity disappears: instead of a beginning, there is a transition, a “bounce”—the universe contracts, reaches a minimum, and then expands again. Also in string theory, which conceptualizes the fundamental building blocks of matter as vibrating one-dimensional objects, the classical singularity is replaced by new geometries. Space and time could exhibit entirely different properties at the extreme scales of the Planck length—perhaps even emerging from deeper layers of informational structures. The idea of a universe without a singularity revolutionizes our image of the origin. In place of an absolute beginning, there is a transformation. Instead of a moment of birth, a shift in states. And with this, a new chapter opens in the ontology of possibility—one in which being does not burst forth from nothingness, but arises through continuity and structure.
8. Philosophical Problems with Infinity and Causal Regress The idea of a universe without a beginning—eternal and unbounded into the past—may at first seem elegant. But philosophically, this notion is not without problems. A true, “completed” infinity in the real world presents severe logical difficulties: how could an infinite chain of causal events have ever been traversed to culminate in the here and now? The so-called causal regress—an infinite sequence of causes, each relying on a previous one—seems to erode the very idea of explanation. If every state is explained only by an earlier one, and there is never a “first ground,” an epistemic void emerges: there is always one step before, but never a solid foundation. On the other hand, the idea of a first cause that itself remains uncaused is also hard to accept. Is an unmoved mover not a paradox in itself? Or are we perhaps reaching the limits of our causally structured thinking—thinking that is suited to processes within the world, but not to the world as a whole? The ontology of possibility suggests that both infinite regress and first causes may be mental constructs shaped by the architecture of our consciousness. Perhaps the origin is not defined by causality at all—but by the actualization of potential—and thus lies beyond the logic of “before” and “after.”
II. The Universe Through a Transcendent Entity: The Thought of a Creator 1. The Classical Cosmological Argument: First Cause as a Necessary Being The cosmological argument is one of the oldest philosophical attempts to explain the existence of the universe by positing a transcendent cause. In its classical form, it goes as follows: Everything that has a beginning must have a cause. Since the universe appears to have a beginning—such as through the Big Bang—it too must have a cause. This first cause, so the conclusion goes, cannot itself be caused and must therefore exist necessarily, eternally, and independently. In the Western tradition, this “first cause” has often been equated with God. Aristotle spoke of the “unmoved mover,” and Thomas Aquinas developed from it his famous “five ways” to the knowledge of God. Modern versions, such as the Kalam Cosmological Argument, draw on this framework with renewed focus on the temporal finitude of the world. However, the argument raises important questions: Does causality apply outside of spacetime? Can a causal concept be meaningfully applied to the entire universe, if causality itself is an inner-worldly principle of order? And why should this first cause necessarily be personal or intentional? Despite such challenges, the argument remains powerful—not as strict proof, but as an expression of a deep intellectual need for ultimate grounding. Within an ontology of possibility, it may be read as an indication: Where all things are contingent, it seems reasonable to ask for the non-contingent—not as dogmatic assertion, but as the opening of a philosophical horizon.
2. Fine-Tuning as a Hint of Intention? One of the most fascinating discoveries of modern physics is the extreme sensitivity of the universe to its initial conditions. If certain fundamental constants—such as the gravitational constant, the electromagnetic coupling, or the mass ratio of protons to electrons—had deviated only slightly, there would be no stars, no stable elements, no life. This fine-tuning is interpreted by some as a strong indication of deliberate calibration—as if someone had adjusted the cosmic parameters with utmost precision. The probability of a life-permitting universe seems astronomically low, and yet here we are. Mere chance? Necessity? Or a sign of intention? This is where the so-called teleological argument enters: Where high order meets low probability, the idea of an intentional designer seems plausible. This leads to hypotheses of a “cosmic architect,” a purposeful design, or even a goal behind creation. But this interpretation is not without alternatives. Physical counter-models—such as the multiverse theory—propose that countless universes exist with different parameters, and we just happen to be in one that allows for observers. The anthropic principle, in this light, does not explain why the universe is the way it is, but why we can observe it this way: only in such a universe can we exist. Yet the question remains: Is there such a thing as chance on this level? Or is fine-tuning a hint toward hidden, undiscovered principles? Perhaps it is not an argument for a creator—but a window into the deep interplay between possibility, structure, and consciousness.
3. Consciousness and Morality as Traces of a Mental Source While many aspects of the physical world can be explained by natural laws, consciousness and morality remain mysterious. Why do we experience the world subjectively—with sensations, thoughts, and emotions—rather than functioning as purely mechanical systems? Why do we consider certain actions to be “good” or “evil,” even when they bring us no obvious benefit? Some philosophers and theologians see in this a trace of a spiritual source: if consciousness is not merely emergent but fundamental—perhaps even structuring reality itself—then it seems plausible to postulate a conscious instance at the origin. Similarly, the existence of universal moral intuitions might be interpreted as a reflection of a spiritual order. These considerations often lead to arguments for a “spiritual foundation of the world.” But many questions remain open: Can consciousness be fully explained by neural processes? Or is it—as panpsychist traditions suggest—a basic property of reality? And what do moral intuitions mean in a cosmic context: Are they cultural, biological, metaphysical? The ontology of possibility makes it possible to understand the mental or spiritual as either emergent or fundamental. Whether as an expression of a creator or as an immanent structure of the cosmos—consciousness and morality might be windows into that dimension of being which cannot be captured in formulas, yet nevertheless exerts a real influence.
4. Science at the Edge of Explanation The natural sciences have achieved remarkable things—from the quantum realm of particles to the farthest reaches of galaxies. But the deeper they dig, the more frequently they encounter questions that are no longer merely empirical, but fundamental: Why are there laws of nature at all? Why are they mathematically expressible? Why are we able to comprehend them? Science describes what happens—but often not why anything happens at all. Its methods are designed for what is repeatable and measurable, not for the singular or metaphysical. When it comes to ultimate explanations—such as the “why” of the universe or the source of all possibility—we begin to approach the terrain of metaphysics. This does not mean that scientific inquiry ends—but it changes character. At the boundaries of what can be explained, science becomes speculative, methodologically philosophical, or even poetic. Where no experiment is possible—because no time “before time” is accessible—only thought remains. And perhaps: wonder. In an ontology of possibility, this means: science is a powerful instrument for recognizing possibilities, but it remains itself part of a greater structure that it cannot fully explain. The origin of explicability itself may lie beyond its limits—and that is where the space begins in which possibility becomes world.
III. The Enigma of Nothingness and the Birth of Possibility 1. What Is "Absolute" Nothingness? – Kuhn’s Nine Degrees of Emptiness The question of nothingness is not simply rhetorical—it is ontological. Stephen Kuhn differentiates nine increasingly radical levels of “nothing,” ranging from empty space with no visible objects (but still with laws and quantum fluctuations), to a state devoid of spacetime, matter, energy, laws, consciousness, even mathematical structures or logical propositions. At the most radical level, not even possibility itself remains. This classification shows how difficult it is to define “nothingness” in absolute terms. Most cosmological models start not from pure non-being, but from a physical or mathematical substratum that still harbors laws and structures. The metaphysical “nothing,” however, must exclude even the capacity for emergence. Perhaps it is precisely this inconceivability that makes nothingness so fruitful: as a limit of thought, it thrusts possibility back into the foreground.
2. Ontological Fluctuation: When Nothing Begins to Long for Being Let us imagine a nothingness that is not empty, but remains in a state of ontological tension. It is not full of things, but full of a drive toward possibility. Just as a seed carries the entire potential of a tree within it without yet being a tree, so too could nothingness be understood as the bearer of pure potentiality. In this image, nothingness begins to “fluctuate”—not physically, but conceptually, before any spacetime framework. It longs—in a poetic-metaphysical sense—to become something. This “desiring” is not an intentional act, but a structural urge toward self-transcendence: nothingness becomes origin because it cannot remain “nothing” permanently. A kind of metaphysical instability might be at work here: pure nothingness may not be stable—it would have to dissolve into possibility.
3. Potentiality as a Third Realm Between Nothingness and Being Between absolute nothingness and concrete being lies a sphere that is rarely treated systematically: the realm of possibilities. These are neither nothing – for they have a structure – nor actualized being – for they are not manifest. Aristotle spoke of dynamis, the potentiality inherent in every substance to be actualized. Medieval scholasticism discussed the relationship between potency and act. In modern philosophy, this "in-between" was long neglected until approaches such as modal realism (David Lewis) or process philosophy (Whitehead) opened up this field anew. Possibility as an ontological third means: that which can be has already a kind of reality – at least as structure, as a space of order, as a field. In the ontology of possibility, this intermediate world is not a secondary matter, but the primal ground of becoming.
4. Leibniz Reconsidered: The Necessity of Possibility Leibniz asked: "Why is there something rather than nothing?" But one can reformulate this question: Is "nothing" even a stable option? Or is "something" inevitable, because possibility itself cannot be extinguished? If possibility is a kind of metaphysical basic condition – not produced, but presupposed – then existence is not mere chance. Then the cosmos is not a whim, but a necessary unfolding. Leibniz's question would thus not be answered by a god, but by possibility itself: it presses toward reality because nothingness cannot permanently resist it. The ontology of possibility does not think of possibility as weakness, but as strength. Not as absence, but as source.
IV. Ontology of Possibility – What Could Be and What Becomes 1. Types of Possibility: Logical, Physical, Metaphysical Possibility is not always the same. Philosophy distinguishes between different levels on which something can be considered "possible" – each with its own conditions and limits.
This distinction helps to differentiate the ontology of possibility. For not everything that is logically conceivable is also physically realizable. And not everything that seems physically impossible is metaphysically excluded.
2. Are Possibilities Real? Thoughts from Lewis, Whitehead, Plantinga The status of possibilities is disputed: Are they mere thought experiments – or real entities?
What these approaches have in common is this: possibility is more than imagination. It forms a field of order in which being is realized. The ontology of possibility asks: Do these fields exist independently of thought – or only within it?
3. How Does a Possibility Become Actual? What allows something to pass from the realm of the possible into the actual? Is it randomness, lawfulness, necessity—or will? In physics, measurement or symmetry breaking often selects one outcome among many. In metaphysics, the mechanism is less clear. Some speak of a “principle of plenitude,” where every real possibility must be realized somewhere. Others emphasize choice, context, or causal networks. Possibility becomes actual not through sheer logic, but through interplay: of constraints, chance, form, and perhaps intention. Becoming is not simple derivation—it is transformation.
4. Physical Traces of the Possible in the Cosmos Even within the physical universe, we find echoes of the possible. Superposition in quantum mechanics, multiverse models in cosmology, and the probabilistic nature of particle behavior all point to a cosmos that is not fixed, but branching, fluid, and open. These traces suggest that possibility is not just a background condition, but an active dimension of reality. The universe is not a machine grinding forward—it is a garden of bifurcations, where every actuality is also a crossroads. To study the universe, then, is not only to describe what is—but to glimpse what might have been, and what still might be.
V. The Evolution of Being – Stages of Emergence from Possibility 1. Ontological Evolution: From Pure Potential to Something In the beginning was not the thing, but the capacity – not the fact, but the potential. The evolution of being begins in a sphere where nothing yet "is", but much "can become". Ontological evolution describes the transition from the space of possibility to manifestation – from pure potency to first actuality. This transition is not a one-time act, but a process. In it, orders, distinctions, tensions unfold. Perhaps the first reality was not matter, but form – a pattern, a rhythm, a difference. Only from that arise fields, forces, structures. Being does not begin with substance, but with relation.
2. Physical Evolution: Energy, Fields, Space-time, Galaxies With the physical universe begins the measurable world: space, time, energy, matter. The Big Bang – whether conceived as singularity, bounce, or quantum fluctuation – marks the first great unfolding of the possible into extension. Fields differentiate: gravitation, electromagnetism, strong and weak interaction. Energy gives rise to subatomic particles; from these subparticles, atoms emerge. Spacetime expands, galaxies form, stars ignite. In this cosmic drama, the possible continues to act: as that which arises from physical necessity, but is not strictly determined. Probabilities guide the path, not laws alone. From order, complexity emerges.
3. Chemical Evolution: Molecules, Compounds, First Complexity On the stage of matter, a new chapter begins: chemistry. From hydrogen and helium, heavier elements emerge. Supernovae hurl them into space. New stars and planets form from this dust. Under certain conditions, atoms combine into molecules – into stable, reactive units. Diversity increases. Organic chemistry begins. Carbon forms long chains, loops, rings. What arises is not only complexity – but also the possibility of self-organization.
4. Biological Evolution: Life, Cells, Differentiation At some point – perhaps on Earth, perhaps elsewhere – life begins. From inorganic complexity arises replication. Molecules store information. Membranes form. The first cell is born. Biological evolution is a play of possibility: mutation, selection, variation. It is not a linear ascent, but a network – a dance of chance with necessity. From single-celled organisms arise multicellular ones; from diversity, differentiation emerges: nervous systems, sensory organs, movement. Life brings forth a new principle: inner coherence. Organisms are more than the sum of their parts. They are embodiments of possibility in dynamic balance.
5. Psychological Evolution: Consciousness, Language, Culture At some point, a being looks up at the sky – and asks. With consciousness, the world enters into itself. It arises. The world begins to reflect upon itself: subjectivity, inner world, memory. Language enables complex communication. Culture stores experience, transmits knowledge, enables art. The human being – as the animal of possibility – becomes the embodiment of a new dimension of being: the spiritual. Now the possible is not only in becoming, but also in thinking.
6. Technological Evolution: Tools, Computers, AI With technology begins the conscious shaping of possibility. Tools are extensions of the body, machines extensions of force, computers multiplications of thought. Technological evolution accelerates. It is based on abstracted, systematic use of possibilities – on mathematics, algorithms, simulation. With artificial intelligence, a new agent emerges: not merely a tool, but a co-thinker. Possibility enters a new phase: it is no longer only discovered, but actively created. The human being, as a being of possibility, begins to transform itself – and perhaps even to redefine the conditions of being.
VI. Layers of Being – From Matter to Transcendence 1. Physical Reality: Matter, Particles, Quantum Fields The lowest level of being is that which we can directly measure, weigh, and calculate: particles, fields, forces. Atoms form molecules, matter condenses into stars and planets. Yet even here – at the very bottom – multiplicity begins. "Solid matter" is a play of fields, probabilities, and spacetime structure. This physical world forms the foundation of all higher levels, but at the same time it is permeated by indeterminacy. What we experience as solid is vibrating possibility.
2. Virtual Particles: Fleeting Events in the Quantum Vacuum In the quantum-physical vacuum, there is a kind of “boiling.” Particles and antiparticles appear and disappear again within time spans permitted by the uncertainty principle. These virtual processes are not measurable in the classical sense – yet they have real effects, for example in the Casimir effect or in Hawking radiation. The existence of these "not quite being" entities shows: being does not begin with stability, but with movement and play. The boundary between being and non-being is fluid.
3. Quantum Reality: Superposition, Entanglement, Tunneling In the quantum world, different rules apply. States overlap, particles exist in several places at once, and what happens in one location can affect a distant particle. The classical notions of locality, identity, and causality are undermined. This level shows that reality is not necessarily unambiguous. It is possibility in action, probability in form. Quantum reality is not irrational, but more deeply structured – and resists simple images.
4. Laws of Nature: Constant Order and Emergent Regularity Laws such as the speed of light, the Planck constant, or gravitation appear fixed and unchangeable. But what is a law of nature? Is it merely a description? Or a prescription? Some theories suggest that even natural laws may "emerge" – for example, in the early phases of the universe or in other cosmological domains. In that case, laws would not be absolute but contingent: orders arising from deeper principles. They too would be “become” possibilities.
5. Abstract Entities: Mathematics, Logic, Structures Numbers do not exist in space, yet we find them everywhere. Equations describe planetary orbits as well as quantum fluctuations. The world is mathematizable – but does that mean it is mathematical? The existence of abstract structures – from set theory to category theory – points to a level where order exists “in itself.” Some philosophers speak of a “Platonic realm” of possible forms, others see mathematics as a language shaped by our neural patterns. But in any case: the abstract is a mode of being.
6. Consciousness: First-Person Perspective, Self-Awareness With consciousness, a new dimension begins. Not only what is matters – but how it is experienced. The world is not only registered, but mirrored, felt, interpreted. This inner side of being remains the greatest mystery of both philosophy and neuroscience. Where does the “I” come from? Is it emergent – or fundamental? Is the subject a mere function, or a principle of its own within the order of being?
7. Social Reality: Symbols, Institutions, Cultural Systems Humans do not live in pure nature, but in meaning. Language, money, laws, rituals – none of these are things, but shared realities. Social reality is what many believe in – and thus it exists. This level shows that being is also intersubjective. It arises through agreement, tradition, power, and communication. It is changeable, but effective – a realm of collective possibility.
8. Transcendental Reality: The Origin Beyond Space and Time Many philosophical, religious, and mystical traditions speak of a reality beyond phenomena: the One, the Absolute, the Dao, God, the Self. This level eludes not only measurement, but often also language. Whether as necessary being, as ground, as emptiness or fullness – transcendental reality is that which underlies everything, but can never be fully grasped. It may not be the final something, but the final possibility: that to which all things point, but which never needs to fully reveal itself.
VII. The Role of Consciousness in the Universe – Observer or Co-Creator?
1. Quantum Mechanics and the Observer Effect In quantum mechanics, the observer plays a paradoxical role. A system exists in a superposition of possible states until a measurement occurs. Only the act of observation "collapses" the wave function – one possibility is actualized, while others vanish. This has led to far-reaching interpretations: Is the observer merely a classical measuring device – or does consciousness itself play an active role in the becoming of the world? Some physicists (such as Eugene Wigner) considered consciousness an indispensable part of quantum theory. Others (like Hugh Everett) developed multiverse models in which every possibility becomes real – just in a different world. One way or another, quantum physics forces us to rethink the role of the observer. Is reality independent of experience? Or is it – at least partially – the product of a relationship between world and mind?
2. Panpsychism: Is Consciousness Fundamental? One of the most radical – and at the same time oldest – answers to the riddle of consciousness is this: it is not a product, but a source. Panpsychism assumes that all things – even elementary particles – possess a kind of inner life. Not in the sense of thinking or feeling, but as a rudimentary capacity for experience. In antiquity, this idea was widespread (for example in Thales or Plotinus), but it was pushed aside in modern times. Today, it is experiencing a renaissance: philosophers like Galen Strawson and Philip Goff advocate a “Russellian” version, in which physical properties describe only the outside – while the inside is phenomenal. If consciousness does not first arise with complex brains, but is a fundamental component of the world, a new ontology emerges: not mind or matter, but mind in matter. The world would then, from the beginning, not only be quantum-structured – but also “sentient” in the broadest sense.
3. The Cosmos as a Process of Reflection If we combine these insights, a picture of the universe emerges that brings itself forth – and, in doing so, becomes aware of itself. The evolution of matter, life, and mind would then not be a coincidence, but a form of cosmic self-realization. In this view, consciousness is not a late effect, but a necessary step. Only in the thought of human beings – and perhaps beyond – does the universe recognize itself. It looks back upon itself through eyes it has created. This is not an anthropocentric worldview, but a dynamic one: the world is not merely observable – it observes itself. In the ontology of possibility, this means: where observation happens, not only knowledge arises, but creation as well. Consciousness is not merely a mirror – but a co-creator.
VIII. Nothingness and Emptiness in Eastern Thought – Daoist and Buddhist Perspectives 1. Buddhist Emptiness (Śūnyatā) as Dynamic Origin In Buddhist thought, śūnyatā – emptiness – is not a deficiency, but a deep insight: everything that exists is empty of an independent, unchanging self. All things arise in dependence on others – conditioned, transient, in constant flux. This emptiness is not nihilistic, but an openness to form, change, and co-being. It is the matrix from which all phenomena emerge, like waves from the sea. The world is not substance, but relation.
2. Daoism: Wu and Wu Wei as the Source of All Form Daoism describes the origin of the universe not in terms of creation, but of unfolding. From wu 无 – non-being – arises you – being. The Dao 道 itself cannot be grasped or named, but is the source of all things. "Wu wei" 无为 means “non-action” in the sense of not interfering with the natural flow. The highest efficacy lies in flowing along, not in control. The origin is not active doing, but silent enabling.
3. Non-Being as the Enabler of All Things In both traditions it becomes clear: non-being is not the opposite of being, but its condition. Only because something is empty can it take on form. Only because something is not fixed can it transform. Emptiness is the creative principle par excellence. It is like the empty space in a bowl – not the material, but what gives it function. Nothingness is not a deficit, but potential.
4. Yin and Yang: Interdependence of Being and Non-Being The Chinese symbol of yin and yang shows that all being is polar in itself. Light and dark, activity and rest, fullness and emptiness interpenetrate one another. There is no pure being without its opposite – and no nothingness without reference to something. In this view, reality is a pulsating cycle. Nothingness is not beyond, but at the heart of being. From this dynamic arise movement, rhythm, and life.
5. Building Bridges to the West: Emptiness, Physics, and Philosophy Eastern concepts of emptiness and non-being offer valuable perspectives for Western thought. In quantum physics, states appear that are not definite. In philosophy, new questions arise: Can being only be understood through non-being? Is reality an open process? An ontology of possibility finds resonance here: the real is not rigid, but open. Non-being is not the absence of everything, but the presence of possibility. Between form and emptiness, between being and non-being, lies the field in which world happens.
IX. Emerging Theories and Open Horizons – New Pathways Toward Existence 1. The Holographic Principle and the Nature of Reality The holographic principle proposes that all the information contained in a volume of space can be described by the information on its boundary. Originally developed in the context of black hole thermodynamics, it implies that our three-dimensional universe might, in some sense, be encoded on a distant two-dimensional surface. This radical idea challenges our basic assumptions about space, dimension, and physical substance. If the universe is fundamentally holographic, what we perceive as solid and extended might be the projection of a deeper, informational order—a profound shift from matter-based to information-based ontology.
2. The Anthropic Principle: Fine-Tuning and the Possibility of Life Why do the physical constants of the universe appear to be precisely tuned to allow for life? The anthropic principle explores this mystery. The weak version states that we can only observe a universe compatible with our existence. The strong version suggests the universe must allow life, implying deeper necessity or intention. Critics see anthropic reasoning as tautological or speculative. However, in multiverse theories, the anthropic principle gains weight: among countless universes with varying constants, only a few allow life—and only there can observers arise. Still, it invites the philosophical question: is life an accident, a selection effect, or a clue to cosmic purpose?
3. Digital Physics and the Simulated Reality Hypothesis Some thinkers propose that the universe is not continuous but discrete at the smallest scales—like a digital computation. Digital physics holds that reality may be based on bits, logic gates, or fundamental information-processing events. This overlaps with the simulation hypothesis: (popularized by Nick Bostrom, among others) if intelligent beings could simulate consciousness and worlds, could our universe be such a simulation? While speculative, this idea gains traction as computing advances. It revives ancient philosophical questions: Is reality as we perceive it real? Or is it a construct of deeper patterns—perhaps the output of a cosmic algorithm?
4. The Limits of Human Understanding and Future Inquiry There may be truths that lie forever beyond our cognitive reach—due to limits of our brains, concepts, or even logic itself. Gödel’s incompleteness theorems show that no formal system can be both complete and consistent. Might similar constraints apply to physical theories? Could the human mind be biologically bounded in what it can grasp? This does not end the quest—it shapes it. Future science may require new languages, symbiosis with artificial intelligences, or a redefinition of what it means to “understand.” The mystery of being may not vanish—but evolve with us.
5. Cosmological Natural Selection: A Self-Reproducing Universe? Lee Smolin proposed that universes may generate “offspring” through black holes – with slightly altered constants of nature. Just as biological evolution works through variation and selection, some cosmologists suggest a natural selection of universes. In this model, universes with laws that favor black hole formation “reproduce” more often—since black holes might spawn new universes via quantum tunneling or other mechanisms. This implies a kind of evolutionary process on a cosmic scale: laws that promote replication dominate over time. Though unproven, it’s a naturalistic alternative to fine-tuning: the universe we observe may be one of the most “fertile” in cosmic reproductive terms.
6. Non-Existence as an Unstable State: Why Something Emerges What if pure nothingness is not stable? In some speculative physics, “nothing” is not the absence of everything, but the absence of structure or distinction. Yet such a state may be inherently unstable, leading to spontaneous emergence of difference—of something. This redefines creation not as intervention, but as transformation: nothingness cannot hold, and thus births being. It resonates with metaphysical ideas of potentiality latent in absence, and with physical ideas of vacuum fluctuation. In this view, nothingness is not inert—it’s the fertile precursor of everything.
7. Quantum Tunneling of a Universe from Nothingness Quantum tunneling allows particles to cross barriers they seemingly cannot. Some models extend this to the universe itself: it could tunnel from a state of “nothing” (no classical space or time) into existence. Alexander Vilenkin and others have proposed such mechanisms. These models envision no pre-existing space, no time, no matter—only quantum laws that permit the sudden birth of a universe. Though counterintuitive, this frames creation as a quantum event. Again, laws are prior to being—a strange inversion of classical metaphysics.
8. The “No-Boundary” Proposal by Hartle and Hawking In the Hartle–Hawking model, the universe has no boundary in time or space—just as the Earth’s surface has no edge, but curves smoothly. This removes the need for a singular “beginning.” Instead of time emerging from a singularity, it transitions from a spatial to a temporal dimension through quantum geometry. The model avoids the paradox of a “before time,” offering a finite yet edgeless cosmos. While difficult to test, it reframes the origin of time itself—not as an explosion, but a smooth surfacing of becoming.
9. The Interplay of Science, Philosophy, and Spirituality Each discipline has its own lens—empirical, logical, intuitive—but they all seek the same thing: understanding. At their best, science grounds us, philosophy questions us, and spirituality opens us. The origin of the universe cannot be fully grasped by one alone. A mature view embraces their interplay—seeking coherence rather than reduction. Being may not be dissected into facts or faith alone, but woven together through reflection, insight, and openness to mystery.
10. The Role of Information Theory in the Study of Existence Is the universe made of matter—or of information? In recent decades, information theory has taken a central place in physics, especially in areas like quantum computing, black hole thermodynamics, and entanglement. Some theorists suggest that “it from bit” (Wheeler) captures a core insight: that all being is fundamentally informational. This reframes ontology: not substance, but relation; not mass, but code. If this is true, the “stuff” of the universe is not stuff—but patterned distinctions across a matrix of potential.
11. The Role of Mathematics in Unraveling Reality Why is mathematics so eerily effective in describing the universe? Is it a human invention—or a discovery of eternal truths? The fact that abstract equations predict real-world behavior (like Einstein’s relativity) suggests that math is deeply entwined with reality. Some see it as the language of nature; others as its foundation. The mystery remains: Do we create math, or does math reveal what is? In either case, mathematics may be the bridge between possibility and actuality—the map of how form becomes fact.
12. Causality, Time, and the Arrow of Being Causality links events—but what if time itself is emergent? Some physicists suggest that time is not fundamental, but arises from entropic gradients, quantum entanglement, or observer perspectives. If true, causality too may be relational. The arrow of time—from past to future—depends on initial conditions and thermodynamic asymmetries. Metaphysically, this challenges our intuition: being unfolds not as a fixed path, but a probabilistic horizon. Time may not be the stage—but a participant in the drama of becoming.
13. The Limits of Language and Conceptual Frameworks All thought is mediated by language—and yet language may be inadequate for ultimate reality. The absolute might not be nameable. From Wittgenstein’s silence to the Buddhist idea of sunyata (Nagarjuna), traditions have recognized that concepts are tools, not truths. They point, but do not grasp. This leads to humility: in our inquiry, we must accept that mystery remains. It is not a flaw of reason, but a boundary of form. Beyond language lies intuition, silence, and the unspoken resonance of the real.
14. Emergence as a Key Concept in the Exploration of Being How does novelty arise? Emergence is the phenomenon where complex systems exhibit properties their parts do not possess. Life, mind, culture—all are emergent. But could being itself be emergent? Perhaps pure potential, layered through structure, gives rise to actuality. The cosmos becomes a history of emergences—each stage adding complexity, depth, awareness. From quantum fields to minds, being unfolds as a choreography of thresholds. Emergence is not just process—it may be essence.
15. Symmetry and Symmetry Breaking as Structuring Principles of the World Symmetry is elegant—and often fundamental. Physics shows that symmetries correspond to conservation laws. But symmetry breaking allows for difference, structure, and life. The early universe was nearly uniform—but small fluctuations, amplified by inflation, seeded galaxies. Thus, imperfection enables form. In art and nature alike, asymmetry creates meaning. The interplay of balance and rupture may be the secret behind all becoming: wholeness born from deviation.
16. The Role of Human Perception in the Interpretation of Reality We do not passively receive the world—we co-create it through perception. Cognitive science reveals that our senses filter, our brain predicts, our culture frames. Reality is not just “out there”—it is also “in here.” This raises a deep question: Is being objective—or participatory? In quantum physics, observation affects outcome. In philosophy, phenomenology explores how consciousness shapes appearance. Perception may not distort reality—it may disclose it through involvement.
17. The Interconnectedness of All Being: A Holistic Perspective From ecology to quantum theory, the message is clear: everything is connected. No part of the universe exists in isolation. Entanglement, feedback loops, ecosystems—all affirm interdependence. Spiritual traditions echo this: the one in the many, the whole in the part. Ontologically, this suggests that being is not atomic, but relational. To be is to relate. In this view, the universe is not a machine of parts—but a living web of mutually arising phenomena. Wholeness is not a conclusion—it is the context of all becoming.
X. Lived Possibility – Practical Dimensions of Ontological Insight
1. Personal Growth: Seeing Oneself as Part of an Open Reality Whoever thinks of the world in terms of possibility also sees themselves as an open project. Identity is not a fixed core, but a form unfolding. Personal development, from this perspective, means: giving space to possibility, trusting in becoming, not clinging to what is already determined. An ontology of possibility supports self-reflection, self-responsibility, and the capacity for transformation. It does not see the human being as a completed entity, but as an open becoming.
2. Decision-Making: Engaging with the Possible, Not Just the Given Decisions are not merely reactions to facts, but acts of shaping. Whoever recognizes and takes possibilities seriously expands the scope of action. Suddenly, not only the obvious is available, but even the improbable becomes thinkable. This attitude sharpens awareness of alternatives, encourages creativity, and liberates from the tyranny of the given. The possible becomes a resource in everyday life.
3. Creativity: Exploring Untrodden Inner Landscapes Art, science, invention – all of them live from the power of the not-yet. Creativity means drawing from possibility. Not only creating new things, but also new perspectives, new questions, new sensitivities. The ontology of possibility roots creativity not only in the subject, but in the world itself. The world is not finished – it is an invitation to co-creation.
4. Intuition and Inner Wisdom: Trusting the Not-Yet-Grasped Intuition is the ability to recognize something as meaningful without clear evidence. In a worldview that takes possibility seriously, intuition gains a legitimate place. It is not irrational – but pre-rational: a sense for what is emerging. Whoever connects with possibility becomes more receptive to subtle signals, to symbolic density, to implicit knowledge. Intuition becomes a compass in the realm of openness.
5. Spirituality and Transcendence: Possibility as a Path to Depth Spiritual experience is often the encounter with another mode of being: beyond the concrete, the fixed, the conceptual. It opens a path to the possible as the deeper, the greater, the ungraspable. An ontology of possibility need not be theistic – but it remains open to transcendence. It does not see the spiritual as opposed to the worldly, but as its deepened dimension. To be possible then means: to understand oneself as part of a greater becoming.
11. Conclusion: Possibility as a primordial ground and bridge between worlds
Possibility as the Primordial Ground and Bridge between Worlds. The integration of scientific models with metaphysical insights into possibility yields a rich, multifaceted perspective on the origin of the universe. Whether through self-organization or a transcendent cause—both views rely on an understanding of possibility as something real, fertile, and foundational. In the end, perhaps reality is not a puzzle to be solved, but a space to be entered—a field of becoming in which each thing unfolds according to what it could be.
Here we are now, dear reader, at the end of our cosmic walk. All explanatory attempts made by physics and the natural sciences share one trait: they replace transcendent, absolute nothingness with a less radical “quasi-nothing,” and then attempt to explain the emergence of the universe from that point on. Whether in involves information, geometry, quantum laws, or an endlessly series of new universes—the origin of these foundational assumptions remains unanswered. Their derivation from absolute nothingness is a metaphysical question—and lies beyond the scope of physics. Just as the “hard problem” of consciousness (qualia) defies the grasp of materialistic monism, so too does the attempt to reduce what has already come into being to the state of not-yet-being. The prefix “meta” in “metaphysics” cannot be erased without reference to a spiritual principle—the primordial ground, the Dao, the Unknowable. “The world is a spiritual vessel.” (Laozi, Daodejing)—Physics may uncover ever-deeper structures of that vessel, but to “reverently venerate the Unknowable” (Goethe) remains the finest wisdom of the soul. —H.A.
Alquiros, Hilmar (2023). Nothingness and Being. Potentialities of Ontological Evolution. — (2025). Leibniz! Genius of Geniuses. — Alquiros, H. (2025). Reality 2.0! Quantum Physics, Consciousness and Beyond.
Carroll, Sean M.
(2019). Something Deeply Hidden: Quantum Worlds and the
Emergence of Spacetime. Dutton.
Chalmers, David J. (1996). The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory. Oxford University Press.
Deutsch, David
(1997). The Fabric of Reality. Penguin Books.
Greene, Brian
(2004). The Fabric of the Cosmos. Vintage Books. Greyson, Bruce (2021). After: A Doctor Explores What Near-Death Experiences Reveal About Life and Beyond. St. Martin’s Essentials.
Hawking, Stephen &
Hartle, James (1983). The no-boundary proposal.
Physical Review D, 28(12), 2960–2975.
Kuhn, Steven R. (2013). Levels of Nothing. Skeptic Magazine, 18(2).
Leibniz, Gottfried Wilhelm
(1714). Principles of Nature and Grace. Lewis, David K. (1986). On the Plurality of Worlds. Blackwell.
Plantinga, Alvin (1974). The Nature of Necessity. Oxford University Press.
Tegmark, Max (2014).
Our Mathematical Universe. Vintage.
Vilenkin, Alexander
(1982). Creation of universes from nothing. Physics Letters B,
117(1–2), 25–28.
Whitehead, Alfred North (1929). Process and Reality. Macmillan. Wilczek, Frank (2021). Fundamentals: Ten Keys to Reality. Penguin Press. Wikipedia (n.d.). Ontological Argument, Modal Realism, Quantum Vacuum Fluctuation, Multiverse Hypothesis, Fine-tuning Argument, Panpsychism.
van Lommel, Pim (2007). Consciousness Beyond Life: The Science of the Near-Death Experience. HarperOne.
Further reading: Bang, Jytte & Winther-Lindqvist, Ditte (2017). Nothingness—Philosophical Insights into Psychology. Springer. Blakeburn, Jonathan (2016). Nothing Matters: Philosophical and Theological Varieties. Cambridge Scholars Publishing. Carew, Joseph (2016). Why Is There Nothing Rather Than Something? De Gruyter. Clarke-Doane, Justin (2021). Metaphysical and Absolute Possibility. Oxford University Press. Godínez, Hugo S. (2017). The Intuition of Nothingness in Aristotelian Thought. Springer. Marmodoro, Anna (2018). Potentiality in Aristotle's Metaphysics. Oxford University Press. Roso, Luka (2010). The Positive Take on Nothingness. Cambridge Scholars Publishing. Sartre, Jean-Paul (2015). Being and Nothingness. Washington Square Press. Sorensen, Roy (2003). Nothingness. Oxford University Press. Tanaka, Yasuo (2010). Philosophy of Nothingness and Process Theology. Nagoya University Press. |
|
📖 Review: Between Nothingness and Being An Essay by Hilmar Alquiros
This philosophical essay by Hilmar Alquiros is a masterfully structured and intellectually ambitious meditation on one of the deepest questions imaginable: Why is there something rather than nothing? Combining scientific cosmology, metaphysics, and ontological speculation, Alquiros explores the possibilities of self-creation, transcendent causality, and the emergence of actuality from pure potential. His concept of an ontology of possibility becomes the central key to bridging opposing worldviews—ranging from quantum fluctuation to divine intentionality. What distinguishes this text is its clarity in explaining complex theories—from multiverse inflation and Leibniz’s contingency principle to Kuhn’s nine levels of nothingness. Alquiros weaves these elements into a coherent framework that is as accessible as it is thought-provoking. Far from speculative extravagance, the essay unfolds in calm precision—inviting readers into a profound dialogue on what it means to exist, to emerge, and to become.
Verdict: A brilliant synthesis of physics, philosophy, and spiritual inquiry. For anyone interested in the deepest questions of existence—and how nothingness itself may be the fertile ground of all things. Thug Catproof, USA |
📘 APA (7th Edition)English: Alquiros, H. (2025). Between Nothingness and Being: The Riddle of Possibilities, Self-Creation and Transcendence. Published at |
📙 MLA (9th Edition)English: Alquiros, Hilmar. Between Nothingness and Being: The Riddle of Possibilities, Self-Creation and Transcendence. 2025. Accessed 14 May 2025. |
![]() ©
by
Dr. Hilmar Alquiros,
The Philippines
Impressum Data
Protection Statement / Datenschutzerklärung
©
by
Dr. Hilmar Alquiros,
The Philippines
Impressum Data
Protection Statement / Datenschutzerklärung ![]()

Zwei Seelen: Hilmar + Lilian
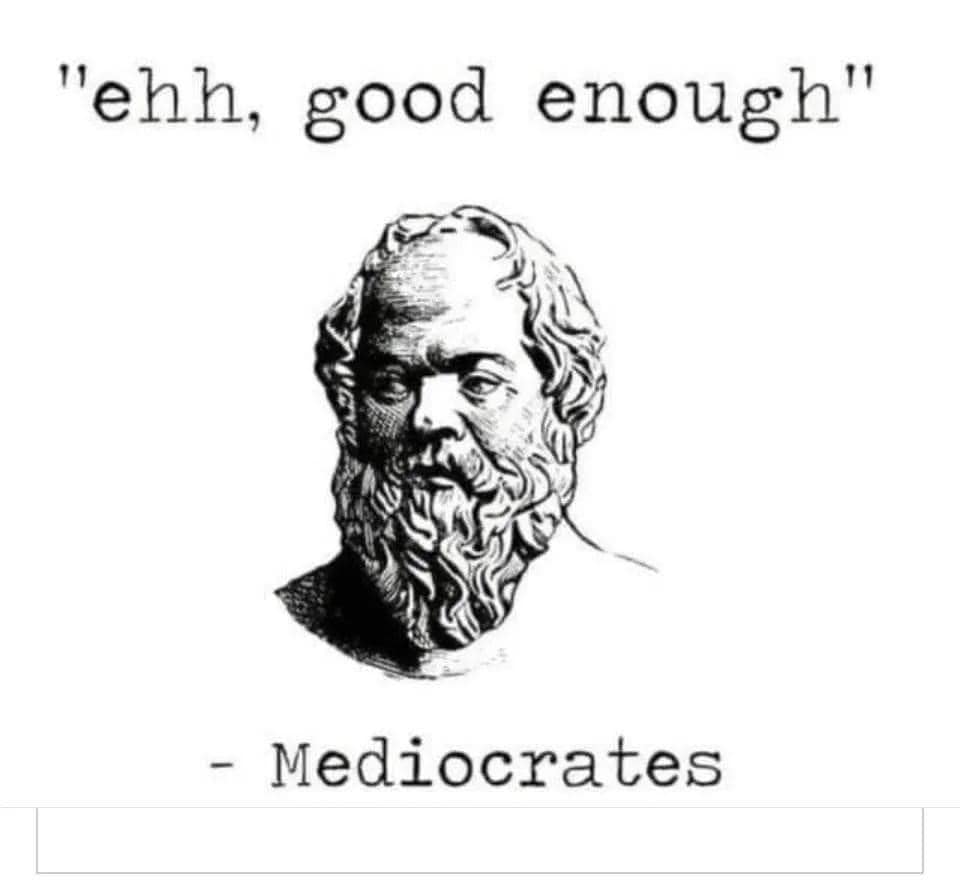

Das Rätsel der Möglichkeiten, Selbsterschaffung und Transzendenz

|
Dieser Essay widmet sich der fundamentalsten aller metaphysischen Fragen: Warum gibt es überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts? Er untersucht zwei konkurrierende Erklärungsansätze für den Ursprung des Universums – die Selbsterschaffung aus physikalischen Gesetzen einerseits, und die Hervorbringung durch eine transzendente Ursache andererseits. Im Zentrum steht dabei der ontologische Status der Möglichkeit, verstanden nicht als bloße Denkform, sondern als reale Dimension des Seins. Die Analyse entfaltet sich über mehrere Ebenen: Quantenfluktuation, kosmologische Modelle, das Rätsel des Nichts und die Entwicklung zunehmender Komplexität von der Physik bis zum Bewusstsein. Unter Einbeziehung westlicher Metaphysik wie östlicher Philosophie entwickelt der Essay eine „Ontologie der Möglichkeit“, die eine Brücke zwischen wissenschaftlichem, philosophischem und spirituellem Denken schlägt. Die Wirklichkeit, so die These, gründet letztlich nicht im Stofflichen, sondern im strukturierten Hervorgehen des Möglichen.
Warum gibt es Etwas und nicht etwa Nichts? Präludium: Der Ursprung der Naturgesetze
I. Das Universum aus sich selbst heraus: Selbstentstehung ohne Schöpfer 1. Quantenfluktuationen als Ursprung eines Kosmos 2. Die Inflationstheorie und das Konzept des Multiversums 3. Zyklische Modelle: Universen ohne Anfang 4. Ockhams Rasiermesser und die Idee der genügenden einfachen Erklärung 5. Hat die Zeit einen Anfang? Kosmologische Überlegungen 6. Thermodynamik und die Richtung der Zeit 7. Quantengravitation: Wenn der Urknall keine Singularität ist 8. Philosophische Probleme mit Unendlichkeit und Kausalregress
II. Das Universum durch eine transzendente Entität: Der Gedanke eines Schöpfers 1. Das klassische kosmologische Argument: Erste Ursache als notwendiges Wesen 2. Feinabstimmung als Hinweis auf Intention? 3. Bewusstsein und Moral als Spuren einer geistigen Quelle 4. Die Wissenschaft am Rand ihres Erklärungsvermögens
III. Das Rätsel des Nichts und die Geburt der Möglichkeit 1. Was ist „absolutes“ Nichts? – Kuhns neun Stufen der Leere 2. Ontologische Fluktuation: Das Nichts beginnt zu wollen 3. Potentialität als drittes Reich zwischen Nichts und Sein 4. Leibniz neu gedacht: Die Notwendigkeit von Möglichkeit
IV. Ontologie der Möglichkeit: Was sein könnte und was wird 1. Arten der Möglichkeit: Logisch, physikalisch, metaphysisch 2. Sind Möglichkeiten real? Gedanken von Lewis, Whitehead, Plantinga 3. Wie wird eine Möglichkeit aktual? 4. Physikalische Spuren des Möglichen im Kosmos
V. Evolution des Seienden – Stufen der Emergenz aus dem Möglichen 1. Ontologische Evolution: Vom reinen Möglichen zum Etwas 2. Physikalische Evolution: Energie, Felder, Raumzeit, Galaxien 3. Chemische Evolution: Moleküle, Verbindungen, erste Komplexität 4. Biologische Evolution: Leben, Zellen, Differenzierung 5. Psychologische Evolution: Bewusstsein, Sprache, Kultur 6. Technologische Evolution: Werkzeuge, Computer, KI
VI. Ebenen des Seins – Von der Materie bis zur Transzendenz 1. Physische Realität: Materie, Teilchen, Quantenfelder 2. Virtuelle Teilchen: Flüchtige Ereignisse des Quantenvakuums 3. Quantische Realität: Superposition, Verschränkung, Tunnelung 4. Naturgesetze: Konstante Ordnung und emergente Regelhaftigkeit 5. Abstrakte Entitäten: Mathematik, Logik, Strukturen 6. Bewusstsein: Erste-Person-Perspektive, Selbstwahrnehmung 7. Soziale Realität: Symbole, Institutionen, kulturelle Systeme 8. Transzendentale Realität: Der Ursprung jenseits von Raum und Zeit
VII. Rolle des Bewusstseins im Universum: Beobachter oder Mitgestalter? 1. Quantenmechanik und Beobachtereffekt 2. Panpsychismus: Ist Bewusstsein grundlegend? 3. Der Kosmos als Reflexionsprozess
VIII. Nichts und Leere im östlichen Denken: Daoistische und buddhistische Perspektiven 1. Buddhistische Leere (Śūnyatā) als dynamischer Ursprung 2. Daoismus: Wu und Wu Wei als Quelle aller Form 3. Das Nichtsein als Ermöglichung aller Dinge 4. Yin und Yang: Interdependenz von Sein und Nichtsein 5. Brückenschlag zum Westen: Leerheit, Physik und Philosophie
IX. Zukünftige Theorien und offene Horizonte: Neue Denkwege zur Existenz 1. Das holografische Prinzip und die Natur der Wirklichkeit 2. Anthropisches Prinzip: Feinabstimmung und die Möglichkeit von Leben 3. Digitale Physik und die Hypothese einer simulierten Realität 4. Die Grenzen menschlicher Erkenntnis und zukünftige Forschungsrichtungen 5. Kosmologische natürliche Selektion: Ein sich selbst reproduzierendes Universum? 6. Nicht-Existenz als instabiler Zustand: Warum aus dem Nichts etwas entsteht 7. Quanten-Tunneling eines Universums aus dem Nichts 8. „No-boundary“-Vorschlag von Hartle und Hawking: Das Universum ohne Rand 9. Das Zusammenspiel von Wissenschaft, Philosophie und Spiritualität 10.Die Rolle der Informationstheorie im Verständnis von Existenz 11.Die Bedeutung der Mathematik bei der Entschlüsselung der Wirklichkeit 12.Kausalität, Zeit und der Pfeil des Seins 13.Die Grenzen von Sprache und Begrifflichkeit im Denken des Absoluten 14.Emergenz als Schlüsselbegriff in der Erforschung des Seins 15.Symmetrie und Symmetriebruch als strukturierende Prinzipien der Welt 16.Die Rolle der menschlichen Wahrnehmung in der Deutung von Realität 17.Verwobenheit allen Seins: Eine ganzheitliche Perspektive
X. Gelebte Möglichkeit: Praktische Dimensionen einer ontologischen Einsicht 1. Persönliche Entwicklung: Sich als Teil einer offenen Wirklichkeit verstehen 2. Entscheidungsfindung: Mit Möglichem statt mit Gegebenem arbeiten 3. Kreativität: Die Erkundung unbetretener innerer Landschaften 4. Intuition und innere Weisheit: Vertrauen in das Noch-nicht-Begriffene 5. Spiritualität und Transzendenz: Die Möglichkeit als Weg zur Tiefe
11. Fazit: Die Möglichkeit als Urgrund und Brücke zwischen Welten
Rezension: Zwischen Nichts und Sein
Warum es etwas gibt und nicht vielmehr nichts? (Leibniz) Die Frage nach dem Ursprung des Universums führt uns an die Grenze des Denkbaren. Sie berührt nicht nur Physik und Kosmologie, sondern wirft auch grundlegende ontologische, metaphysische und sogar spirituelle Fragen auf: Warum gibt es überhaupt etwas – und nicht vielmehr nichts? Gleichzeitig führt sie unweigerlich in das Spannungsfeld zwischen wissenschaftlichen Erklärungsmodellen, philosophischen Annahmen und existenziellen Grenzfragen. Zwei konkurrierende Positionen dominieren die Debatte: (1) die Hypothese eines sich selbst hervorbringenden Universums aus physikalischen Gesetzen heraus, (2) die Annahme eines transzendenten Urgrundes als Ursache. Beide Perspektiven werfen weitere Schlüsselfragen auf – insbesondere zur Natur des Nichts und zur Rolle der Möglichkeit als eigenständiger ontologischer Kategorie: Was bedeutet es, dass etwas möglich ist? Sind Möglichkeiten bloße Denkformen – oder besitzen sie eine eigene Art von Wirklichkeit? Und wie wird eine Möglichkeit zur Wirklichkeit? Dieser Essay geht solchen Fragen aus wissenschaftlicher, philosophischer und spiritueller Perspektive nach. Ziel ist nicht, den Widerspruch zwischen Selbsterschaffung und Schöpfung aufzulösen, sondern ihn auf ein tieferes gemeinsames Fundament zurückzuführen: die Ontologie der Möglichkeit – als Ursprung, Medium und Horizont allen Seins. Bevor wir jedoch in die tiefere Sphäre von Sein und Werden eintreten, sollte ein stilleres, aber ebenso fundamentales Rätsel bedacht werden: die Ordnung der Dinge. Wir leben in einem Universum, das nicht chaotisch oder anarchisch ist, sondern bemerkenswert strukturiert – bestimmt durch Muster, Konstanten und Prinzipien, die wir Naturgesetze nennen. Einige dieser Gesetze gelten für spezifische Bereiche, andere erscheinen universell und grundlegend. Doch was ist ihr Ursprung? Warum folgt überhaupt etwas irgendwelchen Regeln? Bevor wir also fragen, warum es etwas gibt und nicht nichts, sollten wir zunächst dieses Rätsel überdenken: warum es Ordnung gibt statt Unordnung? Warum gehorcht das, was existiert, gesetzmäßigen Strukturen – und nicht bloßem Zufall? Diese Frage ist mehr als nur eine wissenschaftliche – sie ist metaphysisch. Sie fordert uns heraus, darüber nachzudenken, ob diese Gesetze entdeckt oder erfunden, auferlegt oder emergent, ewig oder kontingent sind. Von wissenschaftlichem Naturalismus über Platonismus, theistische Deutungen bis zu Emergenztheorien und Multiversumsmodellen haben Denker verschiedene Ansätze vorgeschlagen, um diese grundlegende Struktur zu erklären. Beginnen wir also unsere Reise zur letzten „Warum“-Frage mit einer ersten, nicht weniger rätselhaften: Warum gibt es überhaupt Naturgesetze?
Präludium: Der Ursprung der Naturgesetze 1 Der wissenschaftliche Naturalismus Der wissenschaftliche Naturalismus geht davon aus, dass Naturgesetze inhärente Muster des physikalischen Universums sind, die durch Beobachtung und empirische Forschung erkannt werden können. Er geht davon aus, dass alle Phänomene durch natürliche Ursachen erklärbar sind – ohne Rückgriff auf das Übernatürliche. Vertreter wie Willard Van Orman Quine, Paul Kurtz oder Sean Carroll – mit seinem Konzept des „poetischen Naturalismus“ – betonen, dass sich aus diesen Gesetzen auch menschliche Sinnzuschreibungen ableiten lassen. Kritiker werfen dieser Sichtweise jedoch vor, die Existenz der Gesetze als gegeben hinzunehmen, ohne sie wirklich zu erklären: Warum diese Gesetze – und nicht andere? Warum überhaupt Gesetzmäßigkeit? Trotzdem bildet dieser Ansatz die methodologische Grundlage moderner Naturwissenschaft. → Laws of Nature, Stanford Encyclopedia of Philosophy
Der Platonismus versteht Naturgesetze als abstrakte, zeitlose Wahrheiten – ähnlich mathematischen Objekten –, die unabhängig von der physischen Welt existieren. Denker wie Roger Penrose oder Max Tegmark vertreten die These, dass das Universum im Kern eine mathematische Struktur sei. Kritiker wie Lee Smolin wenden ein, dass Platonismus zeitliche Dynamik und kausale Wirksamkeit nicht erklären könne und daher Gefahr laufe, das konkrete Geschehen zu entkoppeln. Trotzdem bleibt diese Sicht in der theoretischen Physik und Mathematikphilosophie einflussreich. → Platonic Laws of Nature, Canadian Journal of Philosophy
Theistische Perspektiven gehen davon aus, dass die Gesetzmäßigkeit des Universums aus einer göttlichen Vernunftquelle stammt – einem transzendenten Ursprung der Ordnung. Namen wie Thomas von Aquin, John Polkinghorne oder Francis Collins stehen für Versuche, naturwissenschaftliche Erkenntnis mit religiösem Weltverständnis zu verbinden. Kritiker bemängeln den mangelnden empirischen Gehalt solcher Deutungen und sehen darin eher theologische Deutung denn naturwissenschaftliche Erklärung. Dennoch prägen diese Ansätze den interdisziplinären Dialog an der Schnittstelle von Wissenschaft und Metaphysik. → Theism and Laws of Nature, Harvard Theological Review
Emergenztheorien vertreten die Ansicht, dass das, was wir als „Gesetze“ beobachten, aus der kollektiven Wechselwirkung einfacherer Komponenten hervorgeht. Manche Muster lassen sich nicht auf ihre mikrophysikalischen Bestandteile reduzieren, sondern entstehen erst auf höheren Ebenen der Komplexität. Philosophen wie C. D. Broad oder David Chalmers sowie der Physiker Robert Laughlin setzen sich mit dieser Sichtweise auseinander. Kritiker bemängeln allerdings, dass Emergenz oft unklar bleibe und eher Beobachtungen beschreibe als Erklärungen liefere. Dennoch gewinnt das Konzept insbesondere in den Wissenschaften über Geist, Leben und komplexe Systeme an Bedeutung. → Emergent Properties, Stanford Encyclopedia of Philosophy
5 Multiversum-Theorien und das anthropische Prinzip Multiversum-Theorien und das anthropische Prinzip schließlich schlagen vor, dass unsere Naturgesetze nur eine Möglichkeit unter vielen darstellen. In unzähligen möglichen Universen herrschen jeweils andere Bedingungen – und wir beobachten eben jene, die unsere Existenz ermöglichen. Vertreter wie Brandon Carter oder Leonard Susskind sehen darin eine Erklärung für die Feinabstimmung der Naturkonstanten. Kritiker halten dem entgegen, dass solche Theorien weder überprüfbar noch falsifizierbar seien und somit an der Grenze zum Metaphysischen operieren. Dennoch sind diese Modelle fest im Diskurs der modernen Kosmologie verankert. → Anthropic Principle, Wikipedia
I. Das Universum aus sich selbst heraus: Selbstentstehung ohne Schöpfer 1. Quantenfluktuationen als Ursprung eines Kosmos Die Idee, dass unser Universum aus einem „Nichts“ im physikalischen Sinne – genauer: einem Quantenvakuum – hervorgegangen sein könnte, gehört zu den faszinierendsten Hypothesen moderner Kosmologie. Solche Vakuumzustände sind nicht völlig leer, sondern enthalten ein brodelndes Feld potenzieller Energie, aus dem sich – gemäß der Heisenbergschen Unschärferelation – spontan Teilchen-Antiteilchen-Paare bilden und wieder vernichten können. In manchen Modellen, etwa bei Alexander Vilenkin oder Lawrence Krauss, kann ein ganzes Universum durch eine Quantenfluktuation aus solch einem Grundzustand hervorgehen. Dieses physikalische „Nichts“ ist allerdings kein metaphysisches Nichts, sondern setzt bereits Raumzeitstrukturen oder zumindest physikalische Gesetze voraus. Die Vorstellung eines Universums, das gleichsam „kostenlos“ aus einem Gleichgewichtszustand mit Energie-Summe null auftaucht, verlangt uns eine neue Art des Denkens ab – eine, die Entstehung nicht als Produktion aus Materie, sondern als Manifestation von Möglichkeit begreift. Es entsteht ein Bild von einem Kosmos, der weniger „gemacht“ als vielmehr „geschehen“ ist – aus der Tiefe quantenhaften Potentials.
2. Die Inflationstheorie und das Konzept des Multiversums Die Inflationstheorie wurde entwickelt, um bestimmte Rätsel des klassischen Urknallmodells zu lösen – etwa die bemerkenswerte Homogenität des Kosmos oder seine nahezu perfekte Flachheit. Sie besagt, dass das Universum unmittelbar nach dem Urknall eine extrem rasche, exponentielle Ausdehnung erlebte. Diese kurze Phase, angetrieben von einem hypothetischen Inflatonfeld, glättete Raumkrümmungen und verteilte Energie nahezu gleichmäßig. Diese kurze Phase, angetrieben von einem hypothetischen Inflatonfeld – einem postulierten Skalarfeld, das als Ursache der kosmischen Inflation gilt – glättete die Raumkrümmung und verteilte die Energie nahezu gleichmäßig. Doch die Theorie blieb nicht stehen: In vielen Varianten ergibt sich als Nebeneffekt eine ewig fortschreitende Inflation – ein sich selbst reproduzierender Prozess, bei dem ständig neue Raumblasen entstehen. Unser beobachtbares Universum wäre demnach nur eine dieser „Blasen“, eingebettet in einen viel größeren Raum ewiger Inflation: ein Multiversum. Damit verbindet sich die Idee einer Wirklichkeit, die nicht auf ein einzelnes, abgeschlossenes Universum reduziert ist, sondern aus einem unendlichen Ensemble unterschiedlicher Universen besteht – womöglich mit völlig verschiedenen Naturgesetzen, Dimensionen und physikalischen Konstanten. Die Konsequenz ist sowohl aufregend als auch verstörend: Unsere Welt wäre nicht notwendig, sondern eine Möglichkeit unter unzähligen. Die Inflationstheorie wird so zum kosmologischen Portal in eine neue ontologische Weite.
3. Zyklische Modelle: Universen ohne Anfang Nicht alle kosmologischen Modelle sehen im Urknall den absoluten Anfang von Raum, Zeit und Materie. Schon in der Antike tauchte die Vorstellung eines ewig pulsierenden Kosmos auf, etwa in den Lehren der Stoiker oder im indischen Denken. In der modernen Physik erleben solche Ideen eine Renaissance – etwa im Konzept des „ekpyrotischen Universums“, das aus einem Zusammenstoß höherdimensionaler Branen hervorgeht. Auch die sogenannte Loop-Quantengravitation ersetzt den Urknall durch einen "Big Bounce": ein vorheriges Universum kollabiert nicht in eine Singularität, sondern erreicht einen minimalen Raumzeit-Zustand, von dem aus es sich erneut ausdehnt. Der Zyklus von Kontraktion und Expansion könnte ewig fortdauern. Solche Modelle bieten nicht nur eine Alternative zur Anfangssingularität, sondern auch eine neue Perspektive auf Zeit: Sie wäre nicht linear mit einem Ursprungspunkt, sondern zirkulär oder oszillierend strukturiert. Das Universum wäre damit nicht das Ergebnis eines einmaligen Schöpfungsakts, sondern Ausdruck eines uralten Rhythmus – ein kosmischer Atem, der ewig ein- und ausströmt.
4. Ockhams Rasiermesser und die Idee der genügend einfachen Erklärung Ockhams Rasiermesser – benannt nach dem mittelalterlichen Philosophen Wilhelm von Ockham – ist ein erkenntnistheoretisches Prinzip, das besagt: Von mehreren gleich gut erklärenden Theorien ist die einfachere zu bevorzugen. Einfachheit heißt dabei nicht Naivität, sondern Sparsamkeit im Denken: möglichst wenige unbelegte Annahmen, keine unnötigen Entitäten, keine metaphysischen Überladungen. Auf den Ursprung des Universums angewendet, bedeutet dies: Wenn sich das Universum – auch ohne externe Instanz – durch physikalische Gesetze und innere Dynamiken erklären lässt, sollte man keine zusätzliche Schöpferinstanz postulieren. Eine Theorie, die mit weniger Voraussetzungen auskommt und dennoch dieselben Phänomene beschreibt, verdient den Vorrang. Natürlich bleibt umstritten, ob Einfachheit tatsächlich ein Wahrheitskriterium ist. Doch als heuristisches Werkzeug hat Ockhams Prinzip immense Bedeutung: Es fordert uns auf, das Mysteriöse nicht vorschnell durch das Wunderbare zu ersetzen, sondern die Selbstgenügsamkeit des Realen ernst zu nehmen. In der Ontologie der Möglichkeit wird Einfachheit zum Prüfstein zwischen metaphysischer Tiefe und spekulativer Beliebigkeit.
5. Hat die Zeit einen Anfang? Kosmologische Überlegungen Die Vorstellung eines Anfangs der Zeit selbst wirft eine paradoxe Frage auf: Kann es ein „Davor“ geben, wenn die Zeit selbst erst mit dem Universum beginnt? In klassischen Urknallmodellen markiert die Singularität den Beginn von Raum und Zeit – ein Punkt unendlicher Dichte und Temperatur, an dem unsere physikalischen Theorien versagen. Doch neuere Konzepte deuten darauf hin, dass der Ursprung unseres Kosmos nicht notwendigerweise mit einem absoluten Anfang identisch ist. Die Quantenkosmologie etwa – etwa im Rahmen der Hartle-Hawking-„No-Boundary“-Theorie – schlägt vor, dass Raumzeit an ihrem Ursprung keine Grenze im herkömmlichen Sinne besitzt, sondern eher einer abgerundeten Fläche gleicht. In solch einem Modell ist der Anfang nicht plötzlich, sondern gleitend – Zeit „emergiert“ allmählich aus einer quantenhaften Struktur. Auch philosophisch bleibt die Frage offen, ob ein Anfang der Zeit notwendig oder nur scheinbar ist. Ist Zeit eine grundlegende Dimension oder ein abgeleitetes Phänomen? Kann etwas „beginnen“, ohne von etwas anderem verursacht zu sein? Die Ontologie der Möglichkeit zeigt: Vielleicht ist der Ursprung der Zeit kein fester Punkt, sondern selbst Ausdruck eines Prozesses, in dem Möglichkeit sich zur Erfahrung entfaltet – nicht mit einem Urknall, sondern mit einer Stille, die allmählich zu Puls und Bewegung wird.
6. Thermodynamik und die Richtung der Zeit Die zweite Hauptregel der Thermodynamik – der berühmte Entropiesatz – behauptet, dass in einem abgeschlossenen System die Unordnung, also die Entropie, stets zunimmt. Diese einfache Aussage hat tiefgreifende Konsequenzen: Sie verleiht der Zeit eine Richtung. Während viele physikalische Gleichungen zeitlich reversibel sind, ist die Welt, wie wir sie erfahren, es nicht: Eis schmilzt, aber geschmolzenes Wasser friert nicht von selbst wieder zu – zumindest nicht ohne äußeren Eingriff. In der Kosmologie wirft das eine brisante Frage auf: Wenn das Universum keinen Anfang hätte, sondern ewig existierte, müsste es dann nicht längst einen Zustand maximaler Entropie erreicht haben – eine „thermische Leere“, ohne Struktur, Energiegradienten, Leben? Die Tatsache, dass unser Kosmos noch hochgradig strukturiert ist, spricht dafür, dass er einen Zustand extrem niedriger Entropie durchlaufen hat – was wiederum auf einen Anfang hinzudeuten scheint. Doch auch hier entstehen Gegenmodelle: In zyklischen Universen könnte die Entropie in jedem Zyklus „ausgedünnt“ oder auf eine neue Weise transformiert werden. Andere Ideen postulieren, dass das Universum zwar insgesamt entropisch altert, unser beobachtbarer Ausschnitt jedoch eine lokale Anomalie darstellt. Wie auch immer: Die Richtung der Zeit ist keine triviale Gegebenheit, sondern tief mit dem Zustand und der Geschichte des Universums verknüpft – und damit mit der Frage, ob Sein notwendig ist oder zufällig geschieht. Die Entropie wird so zu einem thermodynamischen Zeiger auf die metaphysische Uhr.
7. Quantengravitation: Wenn der Urknall keine Singularität ist Die klassische Relativitätstheorie beschreibt die Gravitation als Krümmung der Raumzeit – doch sie versagt an einem Punkt: der Urknallsingularität. Dort, wo Dichte und Temperatur unendlich werden, kollabieren die Gleichungen. Um diesen Extremzustand zu verstehen, braucht es eine Theorie der Quantengravitation – eine Vereinigung von Allgemeiner Relativität und Quantenmechanik. Verschiedene Ansätze gehen das Problem auf unterschiedliche Weise an: In der Loop-Quantengravitation wird Raumzeit nicht als Kontinuum, sondern als gequantelte Struktur gedacht – ähnlich einem Netzwerk aus Schleifen. In diesem Modell verschwindet die Singularität: Statt eines Anfangs gibt es einen Übergang, einen "Bounce" – das Universum zieht sich zusammen, erreicht ein Minimum und beginnt erneut zu expandieren. Auch in der Stringtheorie, die die Grundbausteine der Materie als vibrierende eindimensionale Objekte auffasst, wird die klassische Singularität durch neue Geometrien ersetzt. Raum und Zeit könnten in extremen Bereichen der Planck-Skala ganz andere Eigenschaften haben – womöglich sogar emergent aus tieferliegenden Informationsstrukturen. Die Vorstellung eines Universums ohne Singularität revolutioniert unser Bild vom Ursprung. Anstelle eines absoluten Anfangs tritt eine Transformation. Statt einer Geburtsstunde ein Wechsel der Zustände. Und mit ihr eröffnet sich ein neues Kapitel in der Ontologie der Möglichkeit – eines, in dem das Sein nicht aus dem Nichts bricht, sondern durch Kontinuität und Struktur entsteht.
8. Philosophische Probleme mit Unendlichkeit und Kausalregress Der Gedanke eines Universums ohne Anfang – ewig und unbegrenzt in die Vergangenheit zurückreichend – erscheint auf den ersten Blick elegant. Doch philosophisch ist diese Vorstellung nicht unproblematisch. Eine tatsächliche, „vollendete“ Unendlichkeit in der realen Welt birgt schwerwiegende logische Schwierigkeiten: Wie kann eine unendliche Kette kausaler Ereignisse jemals durchlaufen worden sein, um im Hier und Jetzt zu münden? Der sogenannte Kausalregress – eine unendliche Folge von Ursachen, die sich jeweils auf eine frühere Ursache stützen – scheint das Verständnis von Erklärung auszuhöhlen. Wenn jeder Zustand nur durch einen früheren erklärt wird, ohne dass jemals ein „erster Grund“ erreicht wird, entsteht ein Gefühl des epistemischen Leerlaufs: Es gibt immer einen Schritt davor, aber nie eine tragende Basis. Andererseits ist auch die Vorstellung einer ersten Ursache, die selbst unbegründet bleibt, schwer zu akzeptieren. Ist eine unbewegte Ursache nicht selbst ein Paradox? Oder liegt hier vielleicht die Grenze unseres kausal strukturierten Denkens, das für Prozesse innerhalb der Welt geschaffen wurde, nicht aber für das Ganze? Die Ontologie der Möglichkeit legt nahe, dass sowohl unendliche Regress-Ketten als auch erste Ursachen möglicherweise Denkfiguren sind, die aus der Struktur unseres Bewusstseins entstehen. Vielleicht ist der Ursprung nicht durch Kausalität, sondern durch Aktualisierung von Möglichkeit geprägt – und damit jenseits der Logik von „vorher“ und „nachher“.
II. Das Universum durch eine transzendente Entität: Der Gedanke eines Schöpfers 1. Das klassische Kosmologische Argument: Erste Ursache als notwendiges Wesen Das kosmologische Argument gehört zu den ältesten philosophischen Versuchen, die Existenz des Universums durch Rückgriff auf eine transzendente Ursache zu erklären. In seiner klassischen Form lautet es: Alles, was einen Anfang hat, bedarf einer Ursache. Da das Universum offenbar einen Anfang hatte – etwa in Form des Urknalls –, muss auch es eine Ursache haben. Diese erste Ursache, so die Schlussfolgerung, könne nicht selbst verursacht sein und müsse daher notwendig, ewig und unabhängig existieren. In der Tradition des Abendlandes wurde diese „erste Ursache“ oft mit Gott gleichgesetzt. Aristoteles sprach vom „unbewegten Beweger“, Thomas von Aquin entwickelte daraus seine berühmten „fünf Wege“ zur Gotteserkenntnis. Auch moderne Versionen, wie das Kalam-Kosmologische Argument, greifen auf dieses Schema zurück – mit besonderem Fokus auf die zeitliche Endlichkeit der Welt. Doch das Argument wirft Fragen auf: Gilt Kausalität auch außerhalb der Raumzeit? Kann ein kausaler Begriff auf das gesamte Universum angewandt werden, wenn Kausalität selbst ein innerweltliches Ordnungsprinzip ist? Und warum sollte diese erste Ursache notwendigerweise personal oder intentional sein? Trotz dieser Fragen bleibt das Argument kraftvoll – nicht als Beweis im strengen Sinn, sondern als Ausdruck eines tiefen intellektuellen Bedürfnisses nach Letztbegründung. Im Rahmen einer Ontologie der Möglichkeit kann es als Hinweis gelesen werden: Wo alle Dinge bedingt sind, liegt es nahe, nach dem Unbedingten zu fragen – nicht als dogmatische Setzung, sondern als Öffnung eines philosophischen Horizonts.
2. Feinabstimmung als Hinweis auf Intention? Eine der faszinierendsten Entdeckungen der modernen Physik ist die extreme Empfindlichkeit des Universums gegenüber seinen Anfangsbedingungen. Würden einige der Naturkonstanten – wie die Gravitationskonstante, die elektromagnetische Kopplung oder das Verhältnis der Massen von Protonen und Elektronen – auch nur geringfügig abweichen, so gäbe es keine Sterne, keine stabilen Elemente, kein Leben. Diese Feinabstimmung wird von manchen als ein starker Hinweis auf bewusste Setzung interpretiert – als hätte jemand die kosmischen Regler in einem hochkomplexen Kontrollraum exakt justiert. Die Wahrscheinlichkeit für ein lebensfreundliches Universum scheint astronomisch gering, und doch sind wir hier: Zufall? Notwendigkeit? Oder ein Zeichen von Intention? Das sogenannte teleologische Argument greift genau hier an: Wo hohe Ordnung auf geringe Wahrscheinlichkeit trifft, liegt es nahe, eine bewirkende Instanz anzunehmen. Dies führt zu Hypothesen eines „kosmischen Architekten“, einer absichtsvollen Gestaltung oder gar eines Ziels hinter der Schöpfung. Doch diese Interpretation ist nicht alternativlos. Physikalische Gegenmodelle, etwa die Multiversumstheorie, schlagen vor, dass unzählige Universen mit unterschiedlichen Parametern existieren – und wir uns einfach in demjenigen befinden, das Beobachter zulässt. Das anthropische Prinzip erklärt also nicht, warum das Universum so ist, wie es ist, sondern warum wir genau dieses beobachten: Nur in einem solchen kann es uns geben. Die Frage bleibt jedoch: Gibt es überhaupt Zufall auf dieser Ebene? Oder ist die Feinabstimmung ein Hinweis auf verborgene, noch unentdeckte Prinzipien? Vielleicht ist sie kein Argument für einen Schöpfer – aber ein Fenster auf das tiefe Zusammenspiel zwischen Möglichkeit, Struktur und Bewusstsein.
3. Bewusstsein und Moral als Spuren einer geistigen Quelle Während viele Aspekte der physischen Welt durch Naturgesetze erklärbar sind, bleiben Bewusstsein und Moral rätselhaft. Warum erleben wir die Welt subjektiv – mit Empfindungen, Gedanken, Gefühlen – und nicht nur als funktionale Maschinen? Warum empfinden wir gewisse Handlungen als „gut“ oder „böse“, selbst wenn sie uns keinen offensichtlichen Nutzen bringen? Einige Philosophen und Theologen sehen darin Hinweise auf eine geistige Quelle: Wenn Bewusstsein nicht bloß emergent, sondern grundlegend ist – vielleicht sogar strukturgebend für die Wirklichkeit –, dann liegt es nahe, eine bewusste Instanz auch am Ursprung zu vermuten. Ebenso könnte die Existenz universeller moralischer Intuitionen als Reflex einer geistigen Ordnung interpretiert werden. Diese Überlegungen münden oft in Argumente für ein „geistiges Fundament der Welt“. Doch es bleiben viele Fragen offen: Kann Bewusstsein vollständig aus neuronalen Prozessen erklärt werden? Oder ist es – wie in der panpsychistischen Tradition vermutet – ein Grundmerkmal der Realität? Und was bedeuten moralische Intuitionen in einem kosmischen Kontext: Sind sie kulturell, biologisch, metaphysisch? Die Ontologie der Möglichkeit erlaubt es, auch das Geistige als emergente oder grundlegende Möglichkeit zu begreifen. Ob als Ausdruck eines Schöpfers oder als immanente Struktur des Kosmos – Bewusstsein und Moral könnten Fenster in jene Dimension des Seins sein, die sich nicht in Formeln fassen lässt, aber dennoch wirkt.
4. Die Wissenschaft am Rand ihres Erklärungsvermögens Die Naturwissenschaften haben Erstaunliches geleistet: vom Mikrokosmos der Quanten bis zum Fernblick auf Galaxiencluster reicht ihr erklärender Zugriff. Doch je tiefer sie graben, desto häufiger stößt man auf Fragen, die nicht mehr nur empirisch, sondern grundlegend sind: Warum gibt es überhaupt Naturgesetze? Warum sind sie mathematisch formulierbar? Warum sind wir fähig, sie zu erkennen? Die Wissenschaft beschreibt, was geschieht – aber oft nicht, warum überhaupt etwas geschieht. Ihre Methoden sind auf das Wiederholbare und Messbare ausgelegt, nicht auf das Einmalige oder Metaphysische. Wenn es um die Letztbegründung geht – etwa um das „Warum“ des Universums oder die Quelle aller Möglichkeit – beginnt das Terrain der Metaphysik. Das bedeutet nicht, dass wissenschaftliche Erkenntnis aufhört – aber sie verändert ihren Charakter. An den Rändern des Erklärbaren wird die Wissenschaft spekulativ, methodisch-philosophisch oder sogar poetisch. Dort, wo keine Experimente mehr möglich sind, weil keine Zeit vor der Zeit zugänglich ist, bleibt nur das Denken – und vielleicht das Staunen. In einer Ontologie der Möglichkeit bedeutet dies: Wissenschaft ist ein mächtiges Instrument, um Möglichkeiten zu erkennen, aber sie bleibt selbst Teil einer größeren Struktur, die sie nicht vollständig erklären kann. Der Ursprung der Erklärbarkeit selbst könnte jenseits ihrer Grenzen liegen – und dort beginnt der Raum, in dem Möglichkeit zur Welt wird.
III. Das Rätsel des Nichts und die Geburt der Möglichkeit 1. Was ist "absolutes" Nichts? – Kuhns neun Stufen der Leere Das Wort "Nichts" trägt einen scheinbar eindeutigen Klang – als ob es sich dabei um die vollkommene Abwesenheit von allem handelt. Doch bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass das Nichts selbst graduierbar ist. Der Philosoph Stephen Kuhn hat neun Stufen des Nichts formuliert, die sich jeweils durch das Fehlen unterschiedlicher Ebenen von Existenz unterscheiden – von leerem Raum ohne Materie bis hin zu einem Zustand ohne Raum, Zeit, Gesetze, Bewusstsein, Zahlen, Logik und selbst Möglichkeiten. Diese Differenzierung macht deutlich: Was in der Physik oft als "Nichts" bezeichnet wird (etwa ein Quantenvakuum), ist keineswegs metaphysisch leer. Es handelt sich um einen Zustand, in dem Gesetze wirken, in dem sich Energiefluktuationen ereignen und in dem Strukturen denkbar sind. Ein wirklich "absolutes" Nichts, das keine Eigenschaften hat, wäre nicht einmal mehr vorstellbar. Vielleicht ist es gerade diese Unvorstellbarkeit, die das Nichts so fruchtbar macht: Als Grenze des Denkens wirft es die Möglichkeit zurück in den Vordergrund.
2. Ontologische Fluktuation: Das Nichts beginnt zu wollen Stellen wir uns ein Nichts vor, das nicht leer ist, sondern in einem Zustand ontologischer Spannung verharrt. Es ist nicht voller Dinge, sondern voller Drang zur Möglichkeit. So wie ein Same das ganze Potential eines Baumes in sich trägt, ohne selbst schon Baum zu sein, könnte auch das Nichts als Träger reiner Potenzialität verstanden werden. In diesem Bild beginnt das Nichts zu "fluktuieren" – nicht physikalisch, sondern begrifflich, noch vor jedem Raum-Zeit-Gefüge. Es sehnt sich – in einem poetisch-metaphysischen Sinn – danach, Etwas zu werden. Das "Wollen" ist hier kein intentionaler Akt, sondern ein struktureller Drang zur Selbstüberschreitung: Das Nichts wird zum Ursprung, weil es nicht dauerhaft "nichts" bleiben kann. Eine Art metaphysischer Instabilität könnte hier wirken: reines Nichts ist vielleicht nicht stabil – es müsste sich in Möglichkeit auflösen.
3. Potentialität als drittes Reich zwischen Nichts und Sein Zwischen dem absoluten Nichts und dem konkreten Sein liegt eine Sphäre, die selten systematisch behandelt wird: das Reich der Möglichkeiten. Diese sind weder Nichts – denn sie haben eine Struktur – noch aktualisiertes Sein – denn sie sind nicht manifest. Aristoteles sprach vom "Dynamis", der Möglichkeit, die in jedem Stoff ruht, aktualisiert zu werden. Die mittelalterliche Scholastik diskutierte das Verhältnis von Potenz und Akt. In der modernen Philosophie wurde dieses "Dazwischen" lange vernachlässigt, bis Denkansätze wie der modale Realismus (David Lewis) oder die Prozessphilosophie (Whitehead) dieses Feld neu erschlossen. Möglichkeit als ontologisches Drittes bedeutet: Das, was sein kann, besitzt bereits eine Art von Wirklichkeit – zumindest als Struktur, als Ordnungsraum, als Feld. In der Ontologie der Möglichkeit ist diese Zwischenwelt keine Nebensache, sondern der Urgrund des Werdens.
4. Leibniz neu gedacht: Die Notwendigkeit von Möglichkeit Leibniz fragte: "Warum gibt es überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts?" Doch man kann diese Frage neu stellen: Ist "Nichts" überhaupt eine stabile Option? Oder ist das "Etwas" unvermeidlich, weil die Möglichkeit selbst nicht ausgelöscht werden kann? Wenn Möglichkeit eine Art metaphysischer Grundbestand ist – nicht hervorgebracht, sondern vorausgesetzt –, dann ist die Existenz nicht bloßer Zufall. Dann ist der Kosmos keine Laune, sondern eine notwendige Entfaltung. Leibniz' Frage würde damit nicht durch einen Gott beantwortet, sondern durch die Möglichkeit selbst: Sie drängt zur Wirklichkeit hin, weil das Nichts sich ihrer nicht dauerhaft erwehren kann. Die Ontologie der Möglichkeit denkt Möglichkeit nicht als Schwäche, sondern als Kraft. Nicht als Abwesenheit, sondern als Quelle.
IV. Ontologie der Möglichkeit: Was sein könnte und was wird 1. Arten der Möglichkeit: Logisch, physikalisch, metaphysisch Möglichkeit ist nicht gleich Möglichkeit. Die Philosophie unterscheidet verschiedene Ebenen, auf denen etwas „möglich“ sein kann – jede mit eigenen Bedingungen und Grenzen. o Logische Möglichkeit: Alles, was keinen inneren Widerspruch enthält. Ein dreieckiger Kreis ist logisch unmöglich, eine Welt mit fliegenden Schweinen hingegen logisch denkbar. o Physikalische Möglichkeit: Alles, was mit den Naturgesetzen unseres Universums vereinbar ist. Ein Mensch, der durch Wände geht, ist (nach heutigem Wissen) physikalisch unmöglich – aber nicht logisch. o Metaphysische Möglichkeit: Hier geht es um das, was in einem noch umfassenderen Sinn „sein kann“ – etwa unabhängig von unserem Universum. Ist etwa ein Universum mit anderen Naturgesetzen metaphysisch möglich, auch wenn es in unserem nicht realisiert ist? Diese Unterscheidung hilft dabei, die Ontologie der Möglichkeit zu differenzieren. Denn nicht alles, was logisch denkbar ist, ist auch physikalisch realisierbar. Und nicht alles, was physikalisch unmöglich scheint, ist metaphysisch ausgeschlossen.
2. Sind Möglichkeiten real? Gedanken von Lewis, Whitehead, Plantinga Der Status von Möglichkeiten ist umstritten: Sind sie bloße Gedankenexperimente – oder reale Entitäten? o David Lewis vertrat einen „modalen Realismus“: Alle logisch möglichen Welten existieren tatsächlich – jedoch in getrennten Realitäten. Unsere Welt ist nur eine unter unendlich vielen. o Alfred North Whitehead sah die Welt als Prozess: Möglichkeiten sind „ewige Objekte“, die im Akt der Wirklichkeit aufgenommen werden. Sie prägen, was sein kann, auch wenn sie nicht aktualisiert sind. o Alvin Plantinga sprach von „möglichen Wesen“, etwa in seinem ontologischen Gottesbeweis. Für ihn sind Möglichkeiten strukturelle Einheiten des Denkens und Seins – nicht notwendigerweise realisiert, aber gedanklich präzise bestimmbar. Gemeinsam ist diesen Ansätzen: Möglichkeit ist mehr als Einbildung. Sie bildet ein Ordnungsfeld, in dem sich Sein realisiert. Die Ontologie der Möglichkeit fragt: Existieren diese Felder unabhängig vom Denken – oder nur in ihm?
3. Wie wird eine Möglichkeit aktual? The central question is: How does possibility become reality?
In quantum mechanics, we observe the "collapse" metaphor: a quantum system exists in many states simultaneously – until a measurement takes place. Then one possibility becomes reality. But what "decides"? The observer? A chance event? A deeper order? In metaphysical models, actualization can occur through intention, resonance, or emergence. Perhaps reality is not a product, but an event: when the condition is right, possibility breaks through. The world would then be like a fabric that begins to blossom in places – where the space of possibility is open.
4. Physikalische Spuren des Möglichen im Kosmos Auch in der Physik gibt es Hinweise, dass Möglichkeit mehr ist als ein Gedankenraum.
Multiversumstheorien beschreiben die Möglichkeit ganzer Universen mit unterschiedlichen Konstanten. Die Ontologie der Möglichkeit erkennt darin nicht nur theoretische Konzepte, sondern reale Spuren. Vielleicht ist unser Kosmos nicht trotz Möglichkeit entstanden, sondern aus ihr – als ihr leuchtendes Beispiel.
V. Evolution des Seienden – Stufen der Emergenz aus dem Möglichen 1. Ontologische Evolution: Vom reinen Möglichen zum Etwas Am Anfang war nicht das Ding, sondern das Können – nicht das Faktum, sondern das Potenzial. Die Evolution des Seins beginnt in einer Sphäre, in der noch nichts „ist“, aber vieles „werden kann“. Ontologische Evolution beschreibt den Übergang vom Möglichkeitsraum zur Manifestation – vom reinen Vermögen zur ersten Wirklichkeit. Dieser Übergang ist kein einmaliger Akt, sondern ein Prozess. In ihm entfalten sich Ordnungen, Unterschiede, Spannungen. Vielleicht war die erste Realität nicht Materie, sondern Form – ein Muster, ein Rhythmus, eine Differenz. Erst daraus entstehen Felder, Kräfte, Strukturen. Das Sein beginnt nicht mit Substanz, sondern mit Beziehung.
2. Physikalische Evolution: Energie, Felder, Raumzeit, Galaxien Mit dem physikalischen Universum beginnt die messbare Welt: Raum, Zeit, Energie, Materie. Der Urknall – ob als Singularität, Bounce oder Quantenfluktuation gedacht – markiert die erste große Entfaltung des Möglichen in die Ausdehnung. Felder differenzieren sich: Gravitation, Elektromagnetismus, starke und schwache Wechselwirkung. Aus Energie werden subatomare Teilchen, aus diesen Subteilchen Atome. Die Raumzeit dehnt sich aus, Galaxien formieren sich, Sterne zünden. In diesem kosmischen Drama wirkt das Mögliche weiter: als das, was sich aus physikalischer Notwendigkeit ergibt, aber nicht determiniert ist. Wahrscheinlichkeiten lenken den Weg, nicht Gesetze allein. Aus Ordnung entsteht Komplexität.
3. Chemische Evolution: Moleküle, Verbindungen, erste Komplexität Auf der Bühne der Materie beginnt ein neues Kapitel: Chemie. Aus Wasserstoff und Helium entstehen schwerere Elemente. Supernovae schleudern sie ins All. Neue Sterne und Planeten bilden sich aus diesem Staub. Unter bestimmten Bedingungen verbinden sich Atome zu Molekülen – zu stabilen, reaktionsfähigen Einheiten. Die Vielfalt wächst. Organische Chemie beginnt. Kohlenstoff bildet lange Ketten, Schleifen, Ringe. Es entsteht nicht nur Komplexität – sondern auch die Möglichkeit zur Selbstorganisation.
4. Biologische Evolution: Leben, Zellen, Differenzierung Irgendwann – vielleicht auf der Erde, vielleicht anderswo – beginnt Leben. Aus anorganischer Komplexität erwächst Replikation. Moleküle speichern Information. Membranen bilden sich. Die erste Zelle ist geboren. Biologische Evolution ist ein Spiel der Möglichkeit: Mutation, Selektion, Variation. Sie ist kein linearer Aufstieg, sondern ein Netzwerk, ein Tanz des Zufalls mit der Notwendigkeit. Aus Einzellern werden Vielzeller, aus Vielfalt entsteht Differenzierung: Nervensysteme, Sinnesorgane, Bewegung. Das Leben bringt ein neues Prinzip hervor: innerer Zusammenhang. Organismen sind mehr als die Summe ihrer Teile. Sie sind Verkörperungen von Möglichkeit in dynamischem Gleichgewicht.
5. Psychologische Evolution: Bewusstsein, Sprache, Kultur Irgendwann blickt ein Wesen in den Himmel – und fragt. Mit dem Bewusstsein tritt die Welt in sich selbst ein. Es entsteht. Die Welt beginnt, sich selbst zu reflektieren: Subjektivität, Innenwelt, Gedächtnis. Sprache ermöglicht komplexe Kommunikation. Kultur speichert Erfahrung, überträgt Wissen, ermöglicht Kunst. Der Mensch – als Tier der Möglichkeit – wird zur Verkörperung einer neuen Dimension des Seins: der geistigen. Nun ist das Mögliche nicht nur im Werden, sondern auch im Denken.
6. Technologische Evolution: Werkzeuge, Computer, KI Mit der Technik beginnt die bewusste Gestaltung von Möglichkeit. Werkzeuge sind Verlängerungen des Körpers, Maschinen Erweiterungen der Kraft, Computer Multiplikationen des Denkens. Die technologische Evolution beschleunigt sich. Sie basiert auf abstrahierter, systematischer Nutzung von Möglichkeiten – auf Mathematik, Algorithmus, Simulation. Mit künstlicher Intelligenz entsteht ein neuer Agent: nicht bloß Werkzeug, sondern Mitdenker. Die Möglichkeit tritt in eine neue Phase: Sie wird nicht mehr nur entdeckt, sondern selbst erschaffen. Der Mensch als Wesen der Möglichkeit beginnt, sich selbst zu transformieren – und vielleicht sogar die Bedingungen des Seins neu zu definieren.
VI. Ebenen des Seins – Von der Materie bis zur Transzendenz 1. Physische Realität: Materie, Teilchen, Quantenfelder Die unterste Ebene des Seins ist jene, die wir direkt messen, wiegen, berechnen können: Teilchen, Felder, Kräfte. Atome bilden Moleküle, Materie verdichtet sich zu Sternen und Planeten. Doch auch hier – ganz unten – beginnt die Vielschichtigkeit. Die „feste Materie“ ist ein Spiel von Feldern, Wahrscheinlichkeiten und Raumzeitstruktur. Diese physische Welt bildet die Grundlage aller höheren Ebenen, ist aber zugleich durchzogen von Unbestimmtheit. Was wir als solide erleben, ist vibrierende Möglichkeit.
2. Virtuelle Teilchen: Flüchtige Ereignisse des Quantenvakuums Im quantenphysikalischen Vakuum „brodelt“ es. Teilchen und Antiteilchen tauchen auf und verschwinden wieder, innerhalb von Zeiträumen, die von der Unschärferelation erlaubt sind. Diese virtuellen Prozesse sind nicht messbar im klassischen Sinn – doch sie haben reale Auswirkungen, z.B. im Casimir-Effekt oder in der Hawking-Strahlung. Die Existenz dieser „nicht ganz seienden“ Entitäten zeigt: Das Seiende beginnt nicht erst mit Stabilität, sondern mit Bewegung und Spiel. Die Grenze zwischen Sein und Nichtsein ist fließend.
3. Quantische Realität: Superposition, Verschränkung, Tunnelung In der Quantenwelt gelten andere Regeln. Zustände überlagern sich, Teilchen sind gleichzeitig an mehreren Orten, und was an einem Ort geschieht, kann ein weit entferntes Teilchen beeinflussen. Die klassische Vorstellung von Lokalität, Identität, Kausalität wird untergraben. Diese Ebene zeigt, dass Wirklichkeit nicht zwangsläufig eindeutig ist. Sie ist Möglichkeit in Aktion, Wahrscheinlichkeit in Form. Die quantische Realität ist nicht irrational, sondern tiefer strukturiert – und entzieht sich einfachen Bildern.
4. Naturgesetze: Konstante Ordnung und emergente Regelhaftigkeit Gesetze wie die Lichtgeschwindigkeit, die Planck-Konstante oder die Gravitation erscheinen als fest und unveränderlich. Doch was ist ein Naturgesetz? Ist es einfach eine Beschreibung? Oder eine Vorschrift? Manche Theorien deuten an, dass auch Naturgesetze „entstehen“ können – etwa in frühen Phasen des Universums oder in anderen kosmologischen Domänen. Gesetze wären dann nicht absolut, sondern kontingent: Ordnungen, die sich aus tiefer liegenden Prinzipien ergeben. Auch sie wären „gewordene“ Möglichkeiten.
5. Abstrakte Entitäten: Mathematik, Logik, Strukturen Zahlen existieren nicht im Raum, aber wir finden sie überall. Gleichungen beschreiben Planetenbahnen wie Quantenfluktuationen. Die Welt ist mathematisierbar – aber ist sie deshalb mathematisch? Die Existenz abstrakter Strukturen – von Mengenlehre bis zur Kategorientheorie – deutet auf eine Ebene hin, in der Ordnung „an sich“ existiert. Manche Philosophen sprechen von einem „Platonischen Raum“ möglicher Formen, andere sehen in der Mathematik eine Sprache unserer neuronalen Muster. Doch wie auch immer: Das Abstrakte ist eine Seinsweise.
6. Bewusstsein: Erste-Person-Perspektive, Selbstwahrnehmung Mit dem Bewusstsein beginnt eine neue Dimension. Nicht nur das, was ist, zählt – sondern wie es erlebt wird. Die Welt wird nicht nur registriert, sondern gespiegelt, gefühlt, interpretiert. Diese Innenseite des Seins bleibt das größte Rätsel der Philosophie wie der Neurowissenschaften. Woher kommt das „Ich“? Ist es emergent – oder fundamental? Ist das Subjekt eine bloße Funktion, oder ein eigenes Prinzip in der Ordnung des Seins?
7. Soziale Realität: Symbole, Institutionen, kulturelle Systeme Menschen leben nicht in der reinen Natur, sondern in Bedeutung. Sprache, Geld, Gesetze, Rituale – all dies sind keine Dinge, sondern geteilte Wirklichkeiten. Soziale Realität ist das, woran viele glauben – und dadurch existiert es. Diese Ebene zeigt, dass Sein auch intersubjektiv ist. Es entsteht durch Übereinkunft, Tradition, Macht und Kommunikation. Sie ist wandelbar, aber wirkmächtig – ein Reich kollektiver Möglichkeit.
8. Transzendentale Realität: Der Ursprung jenseits von Raum und Zeit Viele philosophische, religiöse und mystische Traditionen sprechen von einer Wirklichkeit jenseits der Phänomene: das Eine, das Absolute, das Dao, Gott, das Selbst. Diese Ebene entzieht sich nicht nur der Messung, sondern auch oft der Sprache. Ob als notwendiges Sein, als Urgrund, als Leere oder Fülle – die transzendentale Realität ist das, was allem zugrunde liegt, aber nie ganz begriffen werden kann. Sie ist vielleicht nicht das letzte Etwas, sondern die letzte Möglichkeit: das, worauf alles verweist, aber das sich nie ganz zeigen muss.
VII. Die Rolle des Bewusstseins im Universum – Beobachter oder Mitgestalter ?
1. Quantenmechanik und Beobachtereffekt In der Quantenmechanik spielt der Beobachter eine paradoxe Rolle. Ein System befindet sich in einer Superposition möglicher Zustände, bis eine Messung erfolgt. Erst der Akt der Beobachtung „kollabiert“ die Wellenfunktion – eine Möglichkeit wird aktualisiert, während andere verschwinden. Dies hat zu weitreichenden Interpretationen geführt: Ist der Beobachter bloß ein klassisches Messgerät – oder spielt das Bewusstsein selbst eine aktive Rolle im Werden der Welt? Manche Physiker (wie Eugene Wigner) hielten Bewusstsein für einen unverzichtbaren Bestandteil der Quantentheorie. Andere (wie Hugh Everett) entwickelten Multiversumsmodelle, in denen jede Möglichkeit real wird – nur in einer anderen Welt. So oder so: Die Quantenphysik zwingt uns, über die Rolle des Beobachters neu nachzudenken. Ist Wirklichkeit unabhängig vom Erleben? Oder ist sie – wenigstens teilweise – das Produkt einer Beziehung zwischen Welt und Geist?
2. Panpsychismus: Ist Bewusstsein grundlegend? Eine der radikalsten – und zugleich ältesten – Antworten auf das Rätsel des Bewusstseins lautet: Es ist nicht Produkt, sondern Ursprung. Der Panpsychismus geht davon aus, dass alle Dinge – auch elementare Teilchen – eine Form von Innenleben besitzen. Nicht im Sinne von Denken oder Fühlen, sondern als rudimentäre Erfahrungsfähigkeit. In der Antike war diese Vorstellung weit verbreitet (etwa bei Thales oder Plotin), wurde in der Neuzeit jedoch verdrängt. Heute erlebt sie eine Renaissance: Philosophen wie Galen Strawson oder Philip Goff vertreten eine „Russellianische“ Version, in der physikalische Eigenschaften nur die Außenseite beschreiben – während die Innenseite phänomenal ist. Wenn Bewusstsein nicht erst mit komplexen Gehirnen auftritt, sondern ein Grundbestandteil der Welt ist, ergibt sich eine neue Ontologie: nicht Geist oder Materie, sondern Geist in Materie. Die Welt wäre dann von Anfang an nicht nur quantisch strukturiert – sondern auch „empfindsam“ im weitesten Sinn.
3. Der Kosmos als Reflexionsprozess Kombiniert man diese Einsichten, ergibt sich ein Bild des Universums, das sich selbst hervorbringt – und dabei erkennt. Die Evolution von Materie, Leben und Geist wäre dann nicht Zufall, sondern eine Form kosmischer Selbstvergegenwärtigung. In dieser Sichtweise ist Bewusstsein nicht ein später Effekt, sondern ein notwendiger Schritt. Erst im Denken des Menschen – und vielleicht darüber hinaus – erkennt sich das Universum selbst. Es blickt durch Augen, die es selbst geschaffen hat, auf sich zurück. Dies ist kein anthropozentrisches Weltbild, sondern ein dynamisches: Die Welt ist nicht bloß beobachtbar – sie beobachtet sich selbst. In der Ontologie der Möglichkeit bedeutet das: Wo Beobachtung geschieht, geschieht nicht nur Erkenntnis, sondern auch Hervorbringung. Bewusstsein ist nicht nur Spiegel – sondern Mitgestalter.
VIII. Nichts und Leere im östlichen Denken – Daoistische und buddhistische Perspektiven 1. Buddhistische Leere (Śūnyatā) als dynamischer Ursprung In der buddhistischen Philosophie ist „Leere“ (śūnyatā) kein Mangel, sondern eine tiefe Einsicht: Alles, was existiert, ist leer von eigenständigem, unveränderlichem Selbst. Alles entsteht in Abhängigkeit von anderem – bedingt, vergänglich, im ständigen Wandel. Diese Leere ist keine nihilistische Leere, sondern die Offenheit für Form, Veränderung und Mitsein. Sie ist die Matrix, aus der alle Phänomene hervorgehen, wie Wellen aus dem Meer. Die Welt ist nicht Substanz, sondern Beziehung.
2. Daoismus: Wu und Wu Wei als Quelle aller Form Der Daoismus beschreibt den Ursprung des Universums nicht in Begriffen von Schöpfung, sondern von Entfaltung. Aus dem „Wu“ 无 – dem Nichtsein – entsteht das „You“ – das Sein. Das Dao 道 selbst ist nicht greifbar, nicht benennbar, aber die Quelle aller Dinge. „Wu Wei“ 无为 bedeutet „Nichthandeln“ im Sinne von Nicht-Eingreifen in den natürlichen Lauf. Die höchste Wirksamkeit liegt im Mitfließen, nicht im Beherrschen. Der Ursprung ist nicht aktives Tun, sondern stilles Ermöglichen.
3. Das Nichtsein als Ermöglichung aller Dinge In beiden Traditionen wird deutlich: Das Nichtsein ist nicht das Gegenteil des Seins, sondern seine Bedingung. Nur weil etwas leer ist, kann es Form annehmen. Nur weil etwas nicht festgelegt ist, kann es sich verwandeln. Leere ist das kreative Prinzip schlechthin. Sie ist wie der leere Raum in einer Schale – nicht das Materielle, sondern das, was ihr Funktion verleiht. Das Nichts ist kein Defizit, sondern Potential.
4. Yin und Yang: Interdependenz von Sein und Nichtsein Das chinesische Symbol des Yin und Yang zeigt: Alles Sein ist in sich polar. Hell und Dunkel, Aktivität und Ruhe, Fülle und Leere durchdringen einander. Es gibt kein reines Sein ohne sein Gegenteil – und kein Nichts ohne Bezug auf etwas. In dieser Sichtweise ist Wirklichkeit ein pulsierender Kreislauf. Das Nichts ist nicht jenseits, sondern im Herzen des Seins. Aus dieser Dynamik entstehen Bewegung, Rhythmus, Leben.
5. Brückenschlag zum Westen: Leerheit, Physik und Philosophie Die östlichen Konzepte von Leere und Nichtsein bieten wertvolle Perspektiven für westliches Denken. In der Quantenphysik erscheinen Zustände, die nicht eindeutig sind. In der Philosophie entstehen neue Fragen: Ist Sein nur durch Nichtsein verständlich? Ist Realität ein offener Prozess? Eine Ontologie der Möglichkeit findet hier Resonanz: Das Wirkliche ist nicht starr, sondern offen. Nichtsein ist nicht die Abwesenheit von allem, sondern die Anwesenheit von Möglichkeit. Zwischen Form und Leere, Sein und Nichtsein, liegt das Feld, in dem Welt geschieht.
IX. Zukünftige Theorien und offene Horizonte – Neue Denkwege zur Existenz 1. Das holografische Prinzip und die Natur der Wirklichkeit Das Holografieprinzip besagt, dass alle Informationen, die in einem Raumvolumen enthalten sind, auch auf seiner Begrenzung beschrieben werden können. Ursprünglich im Kontext der Thermodynamik Schwarzer Löcher entwickelt, impliziert es, dass unser dreidimensionales Universum in gewissem Sinne auf einer fernen zweidimensionalen Oberfläche kodiert sein könnte. Diese radikale Idee stellt unsere grundlegenden Annahmen über Raum, Dimension und physische Substanz infrage. Wenn das Universum im Grunde holografisch ist, könnte das, was wir als fest und ausgedehnt wahrnehmen, die Projektion einer tieferen, informationellen Ordnung sein – ein tiefgreifender Wechsel von einer materiebasierten zu einer informationsbasierten Ontologie.
2. Anthropisches Prinzip: Feinabstimmung und die Möglichkeit von Leben Warum erscheinen die physikalischen Konstanten des Universums so präzise abgestimmt, dass Leben möglich ist? Das anthropische Prinzip untersucht dieses Rätsel. Die schwache Version besagt, dass wir nur ein Universum beobachten können, das mit unserer Existenz kompatibel ist. Die starke Version legt nahe, dass das Universum Leben ermöglichen muss, was auf eine tiefere Notwendigkeit oder Intention hindeuten könnte. Kritiker sehen das anthropische Denken als tautologisch oder spekulativ. In Theorien über ein Multiversum erhält das anthropische Prinzip jedoch mehr Gewicht: Unter unzähligen Universen mit unterschiedlichen Konstanten erlauben nur wenige Leben – und nur dort können Beobachter entstehen. Es stellt sich jedoch weiterhin die philosophische Frage: Ist Leben ein Zufall, ein Selektionsmechanismus – oder ein Hinweis auf kosmische Zielgerichtetheit?
3. Digitale Physik und die Hypothese einer simulierten Realität Einige Denker schlagen vor, dass das Universum nicht kontinuierlich, sondern auf kleinster Ebene diskret ist – wie bei einer digitalen Berechnung. Die digitale Physik geht davon aus, dass die Realität auf Bits, logischen Gattern oder fundamentalen Informationsverarbeitungsereignissen beruht. Dies überschneidet sich mit der Hypothese der Simulation: (unter anderem popularisiert von Nick Bostrom) Wenn intelligente Wesen Bewusstsein und Welten simulieren könnten – könnte unser Universum eine solche Simulation sein? So spekulativ diese Idee auch ist – sie gewinnt angesichts fortschreitender Rechentechnik an Gewicht. Sie belebt alte philosophische Fragen neu: Ist die Wirklichkeit, wie wir sie wahrnehmen, wirklich real? Oder ist sie das Produkt tieferer Muster – vielleicht das Ergebnis eines kosmischen Algorithmus?
4. Die Grenzen menschlicher Erkenntnis und zukünftige Forschungsrichtungen Es könnte Wahrheiten geben, die für immer jenseits unserer kognitiven Reichweite liegen – aufgrund der Grenzen unseres Gehirns, unserer Konzepte oder sogar der Logik selbst. Gödels Unvollständigkeitssätze zeigen, dass kein formales System sowohl vollständig als auch widerspruchsfrei sein kann. Könnten ähnliche Einschränkungen für physikalische Theorien gelten? Könnte der menschliche Geist biologisch begrenzt sein in dem, was er erfassen kann? Das beendet die Suche nicht – es formt sie. Die Wissenschaft der Zukunft könnte neue Sprachen erfordern, eine Symbiose mit künstlicher Intelligenz oder eine Neudefinition dessen, was es bedeutet, zu „verstehen“. Das Rätsel des Seins verschwindet vielleicht nicht – aber es entwickelt sich mit uns.
5. Kosmologische natürliche Selektion: Ein sich selbst reproduzierendes Universum? Lee Smolin schlug vor, dass Universen durch Schwarze Löcher „Nachkommen“ erzeugen könnten – mit leicht veränderten Naturkonstanten. So wie die biologische Evolution durch Variation und Selektion funktioniert, schlagen einige Kosmologen eine natürliche Selektion der Universen vor. In diesem Modell „reproduzieren“ sich Universen mit Gesetzen, die die Bildung von Schwarzen Löchern begünstigen, häufiger – da Schwarze Löcher neue Universen hervorbringen könnten, etwa durch Quanten-Tunneling oder andere Mechanismen. Das impliziert eine Art evolutionären Prozess im kosmischen Maßstab: Gesetze, die Replikation fördern, setzen sich im Lauf der Zeit durch. Auch wenn es nicht bewiesen ist, stellt es eine naturalistische Alternative zur Feinabstimmung dar: Das von uns beobachtete Universum könnte eines der „fruchtbarsten“ im kosmischen Reproduktionssinn sein.
6. Nicht-Existenz als instabiler Zustand: Warum aus dem Nichts etwas entsteht Was, wenn reines Nichts nicht stabil ist? In manchen spekulativen physikalischen Theorien ist „Nichts“ nicht die Abwesenheit von allem, sondern die Abwesenheit von Struktur oder Unterscheidung. Ein solcher Zustand könnte jedoch inhärent instabil sein und zur spontanen Entstehung von Unterschieden – von Etwas – führen. Das definiert „Schöpfung“ nicht als Intervention, sondern als Transformation: Das Nichts kann sich nicht halten und gebiert daher das Sein. Es schwingt mit metaphysischen Ideen von Potenzialität, die in der Abwesenheit latent ist, und mit physikalischen Konzepten wie der Vakuumfluktuation. In dieser Sichtweise ist das Nichts nicht träge – sondern der fruchtbare Vorläufer von allem.
7. Quanten-Tunneling eines Universums aus dem Nichts Quantentunneling erlaubt es Teilchen, Barrieren zu durchqueren, die sie scheinbar nicht überwinden können. Einige Modelle dehnen dies auf das Universum selbst aus: Es könnte aus einem Zustand des „Nichts“ (ohne klassischen Raum oder Zeit) ins Dasein tunneln. Alexander Vilenkin und andere haben solche Mechanismen vorgeschlagen. Diese Modelle sehen keinen vorbestehenden Raum, keine Zeit, keine Materie – nur Quantenregeln, die die plötzliche Geburt eines Universums erlauben. So kontraintuitiv das auch erscheinen mag – hier wird die Schöpfung als Quantenereignis verstanden. Wieder einmal sind Gesetze dem Sein vorausgeschaltet – eine seltsame Umkehrung klassischer Metaphysik.
8. „No-boundary“-Vorschlag von Hartle und Hawking: Das Universum ohne Rand Im Modell von Hartle–Hawking hat das Universum keinen Rand in Raum oder Zeit – so wie die Erdoberfläche keinen Rand hat, sondern sanft gekrümmt ist. Dies macht einen singulären „Anfang“ überflüssig. Anstelle von Zeit, die aus einer Singularität hervorgeht, verwandelt sie sich über Quanten-Geometrie von einer räumlichen in eine zeitliche Dimension. Dieses Modell vermeidet das Paradox eines „Vor der Zeit“ und bietet einen endlichen, aber randlosen Kosmos. Auch wenn es schwer zu überprüfen ist, rahmt es den Ursprung der Zeit neu – nicht als Explosion, sondern als sanftes Auftauchen des Werdens.
9. Das Zusammenspiel von Wissenschaft, Philosophie und Spiritualität Jede Disziplin hat ihre eigene Linse – empirisch, logisch, intuitiv – aber alle streben dasselbe: Verstehen. In ihrem besten Ausdruck verankert uns die Wissenschaft, stellt uns die Philosophie infrage, öffnet uns die Spiritualität. Der Ursprung des Universums kann nicht vollständig durch nur eine dieser Disziplinen erfasst werden. Eine reife Sichtweise begrüßt ihr Zusammenspiel – sie strebt nach Kohärenz statt Reduktion. Sein lässt sich nicht allein in Fakten oder im Glauben zerlegen, sondern entsteht im Gewebe aus Reflexion, Einsicht und Offenheit für das Mysterium.
10. Die Rolle der Informationstheorie im Verständnis von Existenz Besteht das Universum aus Materie – oder aus Information? In den letzten Jahrzehnten hat die Informationstheorie einen zentralen Platz in der Physik eingenommen, insbesondere in Bereichen wie Quantencomputing, Schwarze-Loch-Thermodynamik und Verschränkung. Manche Theoretiker schlagen vor, dass das Prinzip "it from bit" (Wheeler) einen wesentlichen Kern erfasst: dass alles Sein letztlich informell ist. Damit verschiebt sich die ontologische Perspektive: nicht Substanz steht im Zentrum, sondern Relation; nicht Masse, sondern Codierung. Falls dies zutrifft, besteht das "Material" des Universums nicht aus Materie – sondern aus geordneten Unterschieden in einem Feld von Potentialität.
11. Die Bedeutung der Mathematik bei der Entschlüsselung der Wirklichkeit Warum ist Mathematik so erstaunlich effektiv darin, das Universum zu beschreiben? Ist sie eine menschliche Erfindung – oder die Entdeckung ewiger Wahrheiten? Die Tatsache, dass abstrakte Gleichungen reale Phänomene vorhersagen (wie Einsteins Relativitätstheorie), legt nahe, dass Mathematik tief mit der Wirklichkeit verwoben ist. Manche sehen sie als Sprache der Natur, andere als ihr Fundament. Die Frage bleibt: Erschaffen wir Mathematik – oder offenbart sie, was ist? In jedem Fall könnte Mathematik die Brücke zwischen Möglichkeit und Aktualität sein – die Landkarte, wie Form zu Faktum wird.
12. Kausalität, Zeit und der Pfeil des Seins Kausalität verbindet Ereignisse – doch was, wenn Zeit selbst emergent ist? Einige Physiker vermuten, dass Zeit nicht fundamental ist, sondern aus entropischen Gradienten, quantenhaften Verschränkungen oder Beobachterperspektiven entsteht. Wenn das stimmt, könnte auch Kausalität eine relationale Struktur sein. Der Zeitpfeil – vom Vergangenen zum Zukünftigen – hängt von Anfangsbedingungen und thermodynamischen Asymmetrien ab. Metaphysisch stellt dies unsere Intuition in Frage: Sein entfaltet sich nicht entlang eines festen Pfades, sondern auf einem probabilistischen Horizont. Zeit ist dann nicht Bühne – sondern Mitspieler im Drama des Werdens.
13. Die Grenzen von Sprache und Begrifflichkeit im Denken des Absoluten Alles Denken ist durch Sprache vermittelt – und doch könnte Sprache für das Letzte unzureichend sein. Das Absolute lässt sich womöglich nicht benennen. Von Wittgensteins Schweigen bis zur buddhistischen Lehre der Leere (śūnyatā) erkennen viele Traditionen: Begriffe sind Werkzeuge, keine Wahrheiten. Sie weisen – aber sie greifen nicht. Dies führt zu Demut: Wir müssen anerkennen, dass das Geheimnis bleibt. Nicht als Schwäche der Vernunft – sondern als Grenze der Form. Jenseits der Sprache liegen Intuition, Stille und das ungesagte Echo des Wirklichen.
14. Emergenz als Schlüsselbegriff in der Erforschung des Seins Wie entsteht Neues? Emergenz bezeichnet das Phänomen, dass komplexe Systeme Eigenschaften zeigen, die ihre Einzelteile nicht besitzen. Leben, Geist, Kultur – all das ist emergent. Aber könnte auch Sein selbst emergent sein? Vielleicht bringt reine Möglichkeit, strukturell geschichtet, die Aktualität hervor. Der Kosmos erscheint dann als Geschichte von Emergenzen – jede Stufe bringt mehr Komplexität, Tiefe, Bewusstsein hervor. Vom Quantenfeld bis zum Geist entfaltet sich Sein als Choreografie von Schwellen. Emergenz ist nicht nur Prozess – sie könnte Wesen sein.
15. Symmetrie und Symmetriebruch als strukturierende Prinzipien der Welt Symmetrie ist elegant – und oft grundlegend. Die Physik zeigt, dass Symmetrien mit Erhaltungssätzen korrespondieren. Doch der Symmetriebruch ermöglicht Unterschied, Struktur und Leben. Das frühe Universum war fast gleichförmig – doch kleine Fluktuationen, durch Inflation verstärkt, bildeten Galaxien. So wird aus Unvollkommenheit Form. In Kunst und Natur schafft Asymmetrie Bedeutung. Das Zusammenspiel von Ordnung und Bruch könnte das Geheimnis aller Entstehung sein: Ganzheit, geboren aus Abweichung.
16. Die Rolle der menschlichen Wahrnehmung in der Deutung von Realität Wir nehmen die Welt nicht passiv auf – wir gestalten sie durch Wahrnehmung mit. Die Kognitionswissenschaft zeigt: Unsere Sinne filtern, unser Gehirn antizipiert, unsere Kultur rahmt. Wirklichkeit ist nicht nur "draußen", sondern auch "hier drinnen". Daraus ergibt sich eine tiefe Frage: Ist Sein objektiv – oder partizipativ? In der Quantenphysik beeinflusst Beobachtung das Ergebnis. In der Philosophie erforscht die Phänomenologie, wie Bewusstsein Erscheinung formt. Wahrnehmung verzerrt Realität nicht – sie erschließt sie durch Beteiligung.
17. Verwobenheit allen Seins: Eine ganzheitliche Perspektive Von Ökologie bis Quantenphysik lautet die Botschaft: Alles ist verbunden. Kein Teil des Universums existiert isoliert. Verschränkung, Rückkopplung, Ökosysteme – sie alle bezeugen wechselseitige Abhängigkeit. Spirituelle Traditionen klingen darin mit: das Eine im Vielen, das Ganze im Teil. Ontologisch deutet dies auf ein Sein, das nicht atomistisch, sondern relational ist. Sein heißt: in Beziehung stehen. Das Universum ist kein Uhrwerk aus Teilen – sondern ein lebendiges Gewebe sich gegenseitig hervorbringender Phänomene. Ganzheit ist kein Ergebnis – sondern der Kontext allen Werdens.
X. Gelebte Möglichkeit – Praktische Dimensionen einer ontologischen Einsicht
1. Persönliche Entwicklung: Sich als Teil einer offenen Wirklichkeit verstehen Wer die Welt als Möglichkeit denkt, erkennt auch sich selbst als offenes Projekt. Identität ist kein fester Kern, sondern eine sich entfaltende Gestalt. Persönliche Entwicklung bedeutet in dieser Perspektive: der Möglichkeit Raum geben, dem Werden vertrauen, nicht im Festgelegten verharren. Eine Ontologie der Möglichkeit unterstützt Selbstreflexion, Selbstverantwortung und Wandlungsfähigkeit. Sie sieht im Menschen nicht ein abgeschlossenes Wesen, sondern ein offenes Werden.
2. Entscheidungsfindung: Mit Möglichem statt mit Gegebenem arbeiten Entscheidungen sind nicht nur Reaktionen auf Fakten, sondern Akte der Gestaltung. Wer Möglichkeiten erkennt und ernst nimmt, erweitert den Raum des Handelns. Plötzlich ist nicht nur das Naheliegende verfügbar, sondern auch das Unwahrscheinliche denkbar. Diese Haltung schärft das Gespür für Alternativen, ermutigt zur Kreativität und befreit aus der Tyrannei des Gegebenen. Das Mögliche wird zur Ressource im Alltag.
3. Kreativität: Die Erkundung unbetretener innerer Landschaften Kunst, Wissenschaft, Erfindung – sie alle leben von der Kraft des Noch-Nicht. Kreativität heißt, aus dem Möglichen zu schöpfen. Nicht nur Neues zu schaffen, sondern auch neue Sichtweisen, neue Fragestellungen, neue Sensibilitäten. Die Ontologie der Möglichkeit verankert Kreativität nicht nur im Subjekt, sondern in der Welt selbst. Die Welt ist nicht fertig – sie ist Einladung zur Mitgestaltung.
4. Intuition und innere Weisheit: Vertrauen in das Noch-nicht-Begriffene Intuition ist die Fähigkeit, ohne klare Beweise etwas als bedeutsam zu erkennen. In einem Weltbild, das das Mögliche ernst nimmt, erhält Intuition einen legitimen Platz. Sie ist nicht irrational – sondern vor-rational: ein Gespür für das, was sich andeutet. Wer sich mit der Möglichkeit verbindet, wird empfänglicher für leise Signale, für symbolische Dichte, für implizites Wissen. Intuition wird zum Kompass im Reich des Offenen.
5. Spiritualität und Transzendenz: Die Möglichkeit als Weg zur Tiefe Spirituelle Erfahrung ist oft das Erleben einer anderen Seinsweise: jenseits des Konkreten, des Festgelegten, des Begrifflichen. Sie öffnet einen Zugang zum Möglichen als dem Tieferen, dem Größeren, dem Nicht-Fassbaren. Eine Ontologie der Möglichkeit muss nicht theistisch sein – aber sie ist offen für Transzendenz. Sie sieht im Spirituellen keinen Gegensatz zum Weltlichen, sondern dessen vertiefte Dimension. Möglichsein bedeutet dann: sich als Teil eines größeren Werdens verstehen.
11. Fazit: Die Möglichkeit als Urgrund und Brücke zwischen Welten Die Integration von naturwissenschaftlichen Modellen mit metaphysischen Überlegungen zur Möglichkeit ergibt eine vielschichtige Perspektive auf die Entstehung und Struktur der Wirklichkeit. Ob Selbstentstehung oder transzendente Ursache – beide Konzepte setzen letztlich ein Verständnis von Möglichkeit voraus. Eine Ontologie der Möglichkeit eröffnet neue Horizonte: für die Theorie, für das Selbstverständnis, für das Menschsein. Sie ist keine Flucht in Spekulation, sondern eine Einladung zur vertieften Wahrnehmung der Welt – als etwas, das ist, weil es sein konnte.
Hier stehen wir nun, lieber Leser, am Ende unseres kosmischen Spaziergangs. Allen Erklärungsversuchen der Physik und der gesamten Naturwissenschaft ist eines gemeinsam: Sie ersetzen das transzendente, absolute Nichts durch ein weniger radikales "Quasi-Nichts" – und versuchen dann, die Entstehung der Welt ab diesem Ausgangspunkt zu erklären. Ob es sich um Information, Geometrie, Quantengesetze oder eine endlose Folge neue Universen handelt – stets bleibt die Frage offen, woher diese Grundannahmen stammen. Ihre Erklärung aus einem absoluten Nichts heraus bleibt ein metaphysisches Problem – und liegt außerhalb der Physik. Wie schon beim "harten Problem" des Bewusstseins (Qualia), das sich dem Zugriff des materialistischen Monismus entzieht, scheitert auch der Versuch, das bereits Gewordene vollständig auf das "Noch-nicht-Sein" zurückzuführen. Das Präfix "Meta-" vor der "Physik" lässt sich nicht tilgen, ohne auf ein geistiges Prinzip zu verweisen – den "Urgrund", das Dao, das Unergründliche. "Die Welt ist ein Geistgefäß." (Laozi, Daodejing). – Die Physik enthüllt immer tiefere Strukturen des Gefäßes, doch das "Unerforschliche ruhig verehren" (Goethe) bleibt die letzte Weisheit der Seele. – H.A.
Alquiros, Hilmar (2023). Nothingness and Being. Potentialities of Ontological Evolution. — (2025). Leibniz! Genius of Geniuses. — Alquiros, H. (2025). Reality 2.0! Quantum Physics, Consciousness and Beyond.
Carroll, Sean M. (2019). Something Deeply Hidden: Quantum Worlds and the Emergence of Space-time. Dutton. — (2021). The Biggest Ideas in the Universe: Space, Time, and Motion. Dutton. Chalmers, David J. (1996). The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory. Oxford University Press.
Deutsch, David (1997). The Fabric of Reality. Penguin Books. — (2011). The Beginning of Infinity. Viking Press.
Greene, Brian (2004). The Fabric of the Cosmos. Vintage Books. — (2011). The Hidden Reality: Parallel Universes and the Deep Laws of the Cosmos. Knopf. Greyson, Bruce (2021). After: A Doctor Explores What Near-Death Experiences Reveal About Life and Beyond. St. Martin’s Essentials.
Hawking, Stephen & Hartle, James (1983). The no-boundary proposal. Physical Review D, 28(12), 2960–2975. — Hawking, S. (1988). A Brief History of Time. Bantam Books. Kuhn, Steven R. (2013). Levels of Nothing. Skeptic Magazine, 18(2).
Leibniz, Gottfried Wilhelm (1714). Principles of Nature and Grace. — (1710). Théodicée. Lewis, David K. (1986). On the Plurality of Worlds. Blackwell.
Plantinga, Alvin (1974). The Nature of Necessity. Oxford University Press.
Tegmark, Max (2014). Our Mathematical Universe. Vintage. — (2017). Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence. Alfred A. Knopf.
Vilenkin, Alexander (1982). Creation of universes from nothing. Physics Letters B, 117(1–2), 25–28. — (2006). Many Worlds in One: The Search for Other Universes. Hill and Wang.
Whitehead, Alfred North (1929). Process and Reality. Macmillan. Wilczek, Frank (2021). Fundamentals: Ten Keys to Reality. Penguin Press. Wikipedia (n.d.). Ontological Argument, Modal Realism, Quantum Vacuum Fluctuation, Multiverse Hypothesis, Fine-tuning Argument, Panpsychism.
van Lommel, Pim (2007). Consciousness Beyond Life: The Science of the Near-Death Experience. HarperOne.
Weiterführende Literatur: Bang, Jytte & Winther-Lindqvist, Ditte (2017). Nothingness—Philosophical Insights into Psychology. Springer. Blakeburn, Jonathan (2016). Nothing Matters: Philosophical and Theological Varieties. Cambridge Scholars Publishing. Carew, Joseph (2016). Why Is There Nothing Rather Than Something? De Gruyter. Clarke-Doane, Justin (2021). Metaphysical and Absolute Possibility. Oxford University Press. Godínez, Hugo S. (2017). The Intuition of Nothingness in Aristotelian Thought. Springer. Marmodoro, Anna (2018). Potentiality in Aristotle's Metaphysics. Oxford University Press. Roso, Luka (2010). The Positive Take on Nothingness. Cambridge Scholars Publishing. Sartre, Jean-Paul (2015). Being and Nothingness. Washington Square Press. Sorensen, Roy (2003). Nothingness. Oxford University Press. Tanaka, Yasuo (2010). Philosophy of Nothingness and Process Theology. Nagoya University Press. |
Citation: Hilmar Alquiros (2025). Between Nothingness and Being. in: ESSAYS.
|
📖 Review: Zwischen Nichts und Sein Ein Essay von Hilmar Alquiros
Mit seinem neuen Essay legt Hilmar Alquiros ein außergewöhnlich tiefgründiges Werk vor, das sich mit jener Urfrage beschäftigt, die Philosophie, Wissenschaft und Spiritualität gleichermaßen durchzieht: Warum ist überhaupt etwas – und nicht vielmehr nichts? Alquiros entfaltet das Thema mit eindrucksvoller Klarheit und methodischer Weitsicht. Ob Quantenfluktuation oder Gottesbeweis, ob Multiversum oder kontingente Notwendigkeit – stets steht die Ontologie der Möglichkeit im Zentrum, als Brücke zwischen wissenschaftlicher Erklärung und metaphysischer Tiefe. Besonders hervorzuheben ist die gelungene Integration von Denkansätzen aus Ost und West: von Leibniz’ berühmter Frage über die Stufen des Nichts (nach Kuhn) bis zu daoistischen Vorstellungen von Leere und Ursprung. Der Text bleibt dabei stets zugänglich, strukturiert und überraschend poetisch.
Fazit: Ein philosophisch wie sprachlich gelungener Essay über Ursprung, Potenzialität und die leise Kraft des Möglichen. Für Leser, die an der Grenze zwischen Wissenschaft und Weisheit nach Antworten suchen. Thug Catproof, USA
|
📘 APA (7th Edition)Deutsch:
Alquiros, H. (2025).
Zwischen Nichts und Sein: Das
Rätsel der Möglichkeiten, Selbsterschaffung und Transzendenz.
|
📙 MLA (9th Edition)Deutsch:
Alquiros, Hilmar.
Zwischen Nichts und Sein: Das
Rätsel der Möglichkeiten, Selbsterschaffung und Transzendenz.
2025. |
by Dr. Hilmar Alquiros, The Philippines Impressum Data Protection Statement / Datenschutzerklärung
û

Zwei Seelen: Hilmar + Lilian
“” „“